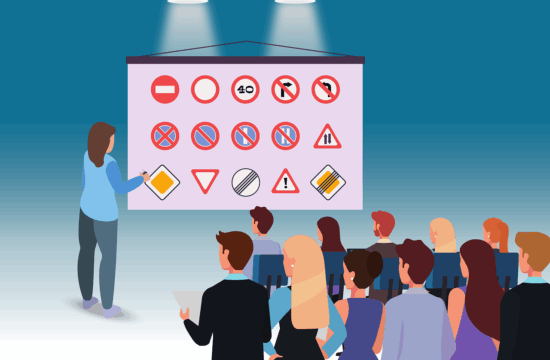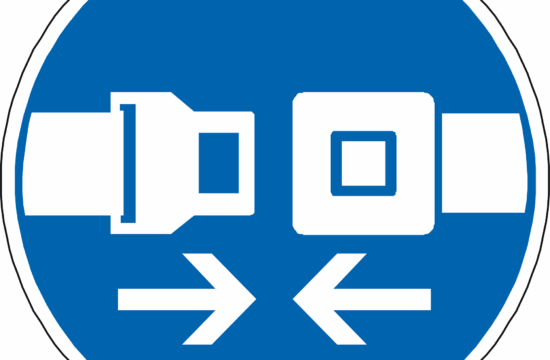DVR-Seminar zeigt, dass die „schöne neue Welt“ mitunter anstrengend sein kann
Es ist nicht überliefert, ob das Multitasking-Genie noch lebt. Der Film, der den Mann bei der kumulativen Handhabung von Print und Online am Lenkrad zeigt, ist immerhin schon acht Jahre alt (und nebenbei im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren bereits eine prähistorische Aufnahme). Der „Fahrer“ liest – aus einem auf gleicher Höhe mit gut 60 Meilen pro Stunde fahrenden zweiten Auto aufgenommen – am Steuer seines Pick-up ein Buch, hantiert dann mit einem Kindle und greift zusätzlich zum Mobiltelefon. Das geht, jedenfalls für 46 Sekunden auch beim nicht-autonomen Fahren. So lang läuft der Clip*, der jetzt einen der Vorträge beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) auflockerte. Titel des jüngsten Medienseminars: „Schöne neue Welt? – Mobilität 4.0“. Gefragt wurde nach den Herausforderungen für die Verkehrssicherheit. Auch auf den Menschen kommen neue zu.
Zu den Erkenntnissen in Höhr-Grenzhausen nahe Koblenz gehörte die Einsicht, dass nicht nur technische Fragen zu fokussieren sind, wenn Systeme sowohl die Quer- als auch Längsführung des Fahrzeugs übernehmen. Zwar muss sich der Fahrer im Unterschied zu heutigen Assistenzsystemen nicht mehr ständig in voller Aufmerksamkeit dem Geschehen im Straßenverkehr beziehungsweise den „Handlungen“ seines Fahrzeugs zuwenden. Jedoch: Solange die Anforderung zum adäquaten Eingreifen ins System bestehen bleibt, resultiert aus der permanenten Bereitschaft sogar eine allgemein höhere Beanspruchung als bei manuellem Steuern. Diese Erkenntnisse ist eigentlich nicht ganz neu, wurde bereits 1983 von der britischen Psychologin Lisanne Brainbridge unter dem Titel „Ironies of Automation“ veröffentlicht.
Die Wechselkosten des Multitaskings
Wer nur überwacht, scheinbar nichts zu tun hat, will Langeweile vermeiden, sucht sich sinnhaft und aktiv zu beschäftigen. Solange aber die Forderung besteht, im Notfall eingreifen zu müssen, kommt die generelle Problematik des Multitaskings ins Spiel: Mit voller Aufmerksamkeit kann sich der Mensch immer nur auf eine Sache konzentrieren, und beim Übergang von der einen zur anderen Tätigkeit geht wertvolle Zeit verloren. Von „Wechselkosten“ spricht Professor Dr. Sebastian Pannasch, Ingenieurpsychologe an der TU Dresden. Er teilt aufgrund seiner Ergebnisse nicht ganz den Optimismus der heute oft genannten Übernahmezeiten um sechs Sekunden und etwas mehr. Er berichtet stattdessen von Werten großer Varianz. Es waren zwar bis zur vollständigen Übernahme der Fahrzeugkontrolle Zeiten wie die von 2,8 Sekunden gemessen. Das andere Ende der Bandbreite lag jedoch bei nicht weniger als 40 Sekunden. Die meisten Probanden brauchten zwischen zehn und 15 Sekunden.
Der selten gehörten Erkenntnis, dass auch Fußgänger Verkehrsteilnehmer sind, widmete Professor Dr.-Ing. Horst Wieker von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes einen Teil seines „Fahrplans für die Zukunft“. Am Fußgänger wird besonders deutlich, wie sich Verkehrsteilnehmer interaktiv beeinflussen; aus den hochkomplexen Strukturen ihrer spezifischen Mobilität ergeben sich auch künftig vielfältige Risiken. Menschen sind „langsam, aber wendig“. Ihre Bewegung hängen stark von inneren und äußeren Umständen ab, aus dem Auto heraus kaum vorhersehbar. Und das Unfallrisiko von Fußgängern steigt andererseits mit deren zunehmenden Wissen über die Technik – wenn sie sich blindlings auf die Funktionen automatisierter Fahrzeuge verlassen. In Jerusalem verunglücken in Vierteln mit vorwiegend orthodoxer Bevölkerung 30 Prozent mehr Fußgänger als andernorts in der Stadt, vertieft in Meditation – oder überzeugt von einem determinierten guten Geschick.
„Die Anforderungen an den Fahrer werden ansteigen“
Zu viel Vertrauen kann auch im Auto zum Problem werden. Für Dr. Thomas Wagner von der DEKRA droht dem Fahrer bei einer reinen überwachenden Tätigkeit nach der Regel „use it or lose it“ langfristig das Verlernen erworbener Kompetenzen. Er stellt daher die Frage nach periodischem Training kritischer Szenarien analog zu jenem für Piloten in den Raum. Damit nicht genug, denn „entgegen der weitverbreiteten Auffassung werden die Anforderungen an den Fahrer künftig ansteigen.“ So müsse an einen (regelmäßigen) Nachweis der erforderlichen persönlichen Voraussetzungen gedacht werden, ebenso an eine Mindestausprägung bei Leistungsvariablen, an einen „Stufenführerschein“ und ans spezifische Ausbildung in Theorie und Praxis.
Neue Risikopotenziale sind für Wagner „in ihrem tatsächlichen Ausmaß derzeit noch nicht umfassend quantifizierbar“. Zu denken sei an neue Unfallarten wie die wegen mangelnder Abstimmung im Mischverkehr (autonom versus klassisch), an Systemgrenzen der Fahrsysteme oder an Bedienfehler des Fahrers. Dazu fürchtet er neue „Delinquenzmuster“ wie Übersteuerung und Systemmissbrauch, Hacker- und Virenangriffe. Der DEKRA-Mann ist zudem nach der Begutachtung von einer gut vierstelligen Zahl von Kandidaten für die MPU (vulgo: „Idiotentest“) völlig desillusioniert, was die Haltung eines gewissen Personenkreises zu Regeln und Normen betrifft. Mit viel Unfug beim Austesten der Grenzen eines Systems sei künftig zu rechnen oder mit dem Versuch, die Technik zu übersteuern.
Leonardo da Vinci wollte beim Fahren nur zusehen
Auch dies kam im Westerwald zur Sprache: Vollautomatisiert gefahren beziehungsweise transportiert werden kann so ohne Weiteres nur eine Minderheit der Spezies Mensch. Die Meisten bilden schon heute Symptome wenigstens körperlichen Unwohlseins aus, wenn sie im Auto ohne Aufmerksamkeit für die vorbeiziehende Landschaft in ihre Lektüre von Buch oder Kindle vertieft sind. Gegen die Fahrtrichtung sitzend, ob in Auto oder Eisenbahn, geht es zahlreichen genau so. Leonardo da Vinci hatte deshalb vielleicht im Jahr 1478 sein dreirädriges Vehikel zum autonomen Fahren so konzipiert, dass es zu klein war, um Menschen zu transportieren. In dem ausgeklügelten mechanischen System griffen alle Elemente wie bei einem Uhrwerk auf komplizierte Weise ineinander. Werden die zum Antrieb bestimmten Sprungfedern in der Trommel gespannt, setzt sich der Wagen in Bewegung – ähnlich wie ein Spielzeugauto, das man aufziehen muss, bevor es losfährt. Aber eben ganz allein.
Erich Kupfer
* https://www.youtube.com/watch?v=r-Cc3Ndjb2k
„Vision Zero ist keine Vision, sondern eine Haltung“,
sagt die Verkehrspsychologin und DVR-Geschäftsführerin Ute Hammer. Seit 2007 ist Vision Zero – eine international eingeführte Bezeichnung – Strategie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zur Vermeidung von Getöteten und Schwerverletzten. Angestrebt ist ein sicheres Verkehrssystem, bei dessen Gestaltung der Mensch als potentielle Fehlerquelle Berücksichtigung finden muss. Die zentralen Annahmen sind: Menschen machen Fehler, haben eine begrenzte physische Belastbarkeit, haben ein Recht auf ein sicheres Verkehrssystem und das Leben ist nicht verhandelbar. Der Denkansatz findet sich international zunehmend in der Arbeitswelt.
Die zehn Forderungen von Vision Zero: Verkehrsüberwachung gezielt verstärken, Höchstgeschwindigkeiten anpassen, Baumunfälle verhindern, Sicherheit für Motorradfahrer erhöhen, Infrastruktur optimieren, Fahrerassistenzsysteme, Automatisierung und Vernetzung forcieren , Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer erhöhen, Fahren unter Einfluss von Drogen und Alkohol verhindern, höhere Qualifizierung von Fahranfängern sowie last, but not least, Gefahren durch Ablenkung verhindern – Finger weg vom Handy! Hammer: „Nicht alles, zu dem die Vision Zero auffordert, ist politisch gewollt.“