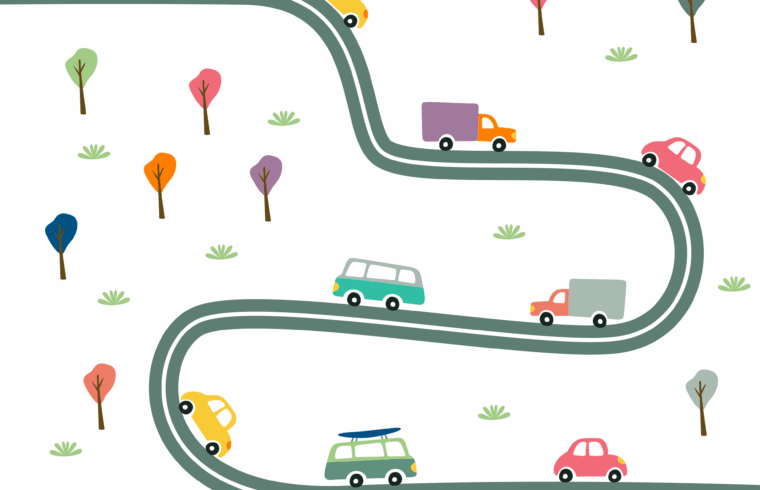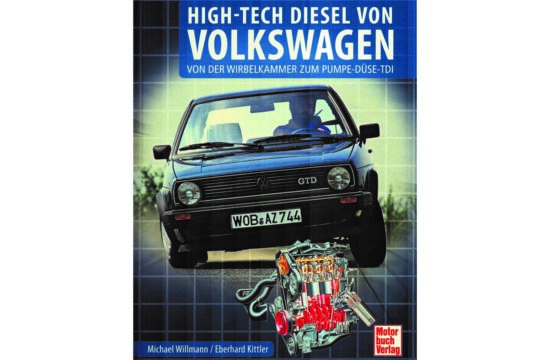Karlsruher Wissenschaftler und Baden-Württembergs Verkehrsminister ziehen positives Fazit nach mehrjährigen Praxistests mit autonom fahrenden Shuttles im ÖPNV. Die Knackpunkte sind bekannt: technische Sicherheit und Akzeptanz
Als 2017 im bayerischen Bad Birnbach erstmals in Deutschland autonom fahrenden Busse von der Deutschen Bahn eingesetzt wurden, bewegten sie sich auf einer zunächst nur 700 Meter langen Teststrecke und nicht schneller als mit 20 km/h. Am Steuer saß immer ein Kontrollfahrer, um aufzupassen, dass die Technik keinen Fehler machte. Mehr als sieben Jahre später, im Oktober 2024, ließen Experten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in einem Forschungsprojekt erneut automatisierte Busse auf der Straße fahren. Auch hier waren Sicherheitsfahrer dabei, doch die Strecken waren länger, komplizierter und variantenreicher als bei der Premiere in Bayern. Das KIT und seine Partner, das baden-württembergische Verkehrsministerium, ein Kfz-Forschungs- und -Dienstleistungsinstitut sowie regionale ÖPNV-Betreiber und der Automobilzulieferer ZF, wollten herausfinden, welche Möglichkeiten auto-nome Shuttles im öffentlichen Personennahverkehr bieten, vor welchen technischen und juristischen Herausforderungen sie dabei stehen und wie es mit der Akzeptanz bei den Fahrgästen aussieht.
„Zuverlässig und sicher“
Beim „Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land“ (RABus), so der Projekttitel, wurden in Friedrichshafen und Mannheim jeweils zwei autonome Kleinbusse eingesetzt, die eigenständig fuhren, aber einen Kontrollfahrer benötigten. Die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge hatten Platz für bis zu zehn Fahrgäste. Während der achtmonatigen Praxisphase wurden bei über 430 Fahrten mehr als 1.600 Fahrgäste mitgenommen und 2.100 Kilometer zurückgelegt – und zwar „zuverlässig und sicher auch bei widrigen Wetterbedingungen und dichtem Verkehr“, wie das KIT zum Projektende stolz verkündete.
Unterschiedliche Herausforderungen
In Mannheim verbanden die Kleinbusse ein Wohngebiet mit der nächsten Straßenbahnhaltestelle. Hier sollten die Fahrzeuge mit dem komplexen Stadtverkehr zurechtzukommen und erreichten dabei Tempo 50 – „eine Geschwindigkeit, die von Bussen in vergleichbaren Projekten in Deutschland bisher noch nicht erreicht wurde“, wie das KIT Institut für Verkehrswesen (IFV) hervorhebt. Während in Mannheim der Fokus also auf dem unübersichtlichen Stadtverkehr lag, ging es für die Testbusse in Friedrichshafen teilweise über die Landstraße, wo sie bis zu 60 km/h schnell wurden. Die acht Kilometer lange Route führte an einem Werksgelände mit Lkw-Verkehr vorbei, an einem Krankenhaus mit Rettungswagen und an ländlichem Gebiet mit Traktoren. Auch das Wetter, Nebel und starker Wind, gehörten zu den Herausforderungen für Fahrzeugcomputer und -sensoren.
Neue und flexible ÖPNV Angebote vor allem auf dem Land
„Mit dem Projekt RABus haben wir gezeigt, dass automatisiertes Fahren im öffentlichen Verkehr kein Zukunftsversprechen, sondern bereits heute erlebbar ist“, fasst Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann das Projektergebnis zusammen. Der Grünen Politiker, dessen Haus eine Fördersumme von 15,8 Millionen Euro einsetzte, sieht Baden-Württemberg „als Erprobungsraum für innovative Mobilitätslösungen“. Aufgrund der Erfahrungen sieht er gute Chancen, automatisierte Kleinbusse als Ergänzung in den ÖPNV aufzunehmen, um „moderne Mobilität für alle zugänglich zu machen“. Welche Gebiete dafür geeignet sind, haben die Forscher durch Simulationen am Computer herausgefunden. Das Ergebnis: „Vielversprechende Anwendungsgebiete haben wir in nahezu allen Gemeinden Baden-Württembergs gefunden“, betont Martin Kagerbauer vom KIT. Seiner Einschätzung zufolge ermöglichen autonome Kleinbusse neue und flexible ÖPNV-Angebote vor allem auf dem Land und in städtischen Randgebieten.
Noch einige Schwierigkeiten
Die Euphorie sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch einige Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen gibt. Zwar berichten die Forscher aus Befragungen von einer „hohen Akzeptanz“ der Fahrgäste, von „großem Nutzungsinteresse“ über alle Bevölkerungsgruppen hinweg und dass „sich Vorbehalte durch Gespräche und das Erleben der Technik abbauen“ ließen. Jedoch scheint es diese Vorbehalte in der Bevölkerung nun einmal zu geben, und der Formulierung der Forscher nach konnten sie auch nicht vollständig ausgeräumt werden.
Endgültiger Abschlussbericht Frühjahr 2026
Das mag mit dem zweiten Problemkreis zusammenhängen: der technischen Unzuverlässigkeit, die den Einsatz der Kontrollfahrer unabdingbar macht. Im Abschlussbericht der ersten RABus Phase hatte es noch geheißen, dass die Kontrollfahrer „vereinzelt“ hätten eingreifen müssen. Konkrete Zahlen wurden nicht veröffentlicht. Verlautbart wurde lediglich, dass nach technischen „Unsicherheiten“ die Software „weiterentwickelt und optimiert“ worden sei. Nun, nach Beendigung der zweiten Testphase im vergangenen Juni, wurden zu diesem Themenkomplex gar keine Angaben mehr gemacht. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Die Antwort wird man bestimmt in dem für das kommende Frühjahr angekündigten endgültigen Abschlussbericht von RABus finden, der ausdrücklich als Grundlage für künftige Vorhaben auch in anderen Bundesländern dienen soll.
Autorin: Beate M. Glaser (kb), Abbildung: pixabay