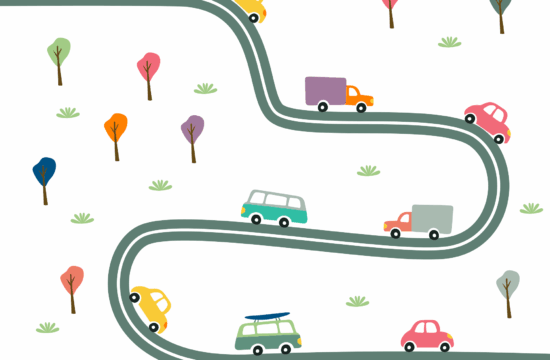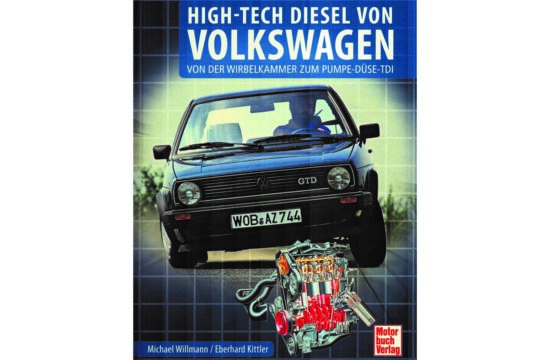Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, Leitmarkt für autonomes Fahren zu werden. Der große Durchbruch hin zu marktreifen Lösungen ist im Gegensatz zu anderen Ländern allerdings noch nicht in Sicht. In einer mehrteiligen Serie im Motorjournalist äußerst sich Prof. Dr. Stefan-Alexander Schneider von der Hochschule Kempten mit dem Fachgebiet Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren zum aktuellen Stand, den Chancen und Risiken sowie den Zielen der autonomen Mobilität. Nachfolgend der erste Teil des Gesprächs mit Prof. Schneider.
Motorjournalist: Aktuell hat das chinesische Autoportal Dongchedi in zwei Tests in China automatisierte Fahrfunktionen unterschiedlicher Autos unter die Lupe genommen (CarNewsChina.com: China’s massive ADAS test: 36 cars, 15 hazard scenarios, 216 crashes). Die Ergebnisse waren ernüchternd. Bleibt das autonome Fahren damit doch eher Zukunftsversprechen und nicht nahende Realität? Wie ist hier der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht? Was ist dringend erforderlich, dass es hier vorangeht und vor allem die Menschen Vertrauen in autonom fahrende Fahrzeuge bekommen?
Prof. Stefan-Alexander Schneider: Autonomes Fahren ist kein reines Zukunftsversprechen mehr, aber noch keine flächendeckende Realität. Technisch ist es bereits heute möglich – in spezifischen Szenarien, mit klaren Betriebsgrenzen und zunehmend robusten Systemen. Die Grundlagen dafür reichen weit zurück – etwa bis zu Ernst Dickmanns, der bereits in den 1980er-Jahren autonom fahrende Fahrzeuge auf öffentlichen Autobahnen demonstrierte (IEEE: Developing the Sense of Vision for Autonomous Road Vehicles at UniBwM). Die Frage ist deshalb längst nicht mehr ob, sondern wann und wie schnell der Markt durchdrungen wird: Werden autonome Fahrzeuge 25, 50 oder gar 100 Prozent des Verkehrs ausmachen – und in welchen Bereichen zuerst? Entscheidend ist dabei nicht nur der technologische Reifegrad, sondern auch die Infrastruktur, die Gesetzgebung, die gesellschaftliche Akzeptanz und die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes – hier müssen wir im System denken. Der Dongchedi Test war ein Blick in den Spiegel – technisch beeindruckend für Tesla, ernüchternd für viele andere. Damit die nächsten Schritte Richtung SAE Level 4 (vgl. Kasten 1) gelingen, braucht es robustes Zulassungsmanagement, transparentes HMI (Anm. der Redaktion: Human Machine Interaction oder Mensch-Maschine-Interaktion) sowie leistungsfähige Infrastruktur inklusive stabiler Teleoperation. Erst wenn Technologie, Regulation und Kommunikation zusammenspielen, kann Vertrauen entstehen – und das autonome Fahren Alltag werden.
Was ist dringend erforderlich, damit das autonome Fahren vorankommt – und das Vertrauen wächst?
Dazu gerne vier Punkte. Erstens, Zulassung & Gesetzgebung: Deutschland hat früh einen gesetzlichen Rahmen für autonomes Fahren geschaffen. Das ist wichtig, aber es täuscht leicht über die Tatsache hinweg, dass wir rechtlich in einer viel strengeren Ausgangslage sind. Als Vertragsstaat der Wiener Straßenverkehrskonvention (United Nations, Treaty Collection: 19. Convention on Road Traffic) ist Deutschland bis heute verpflichtet, dass jedes Fahrzeug einen Fahrer haben muss – was mitunter absurd anmutend Auswüchse haben kann. So musste bei frühen Tests mit autonomen Shuttles in Deutschland offiziell ein Sicherheitsfahrer mitfahren – selbst dann, wenn das Fahrzeug keine Pedale, kein Lenkrad und keinen Sitzplatz für ihn vorgesehen hatte. Solche Konstruktionen führen zu einer absurden Umkehr: Ein „Fahrer“ wird verlangt, obwohl die Maschine längst besser fahren kann – und obwohl er faktisch gar nicht eingreifen kann. Andere Länder wie die z.B. USA oder Japan kennen diese Hürde gar nicht. Sie haben dadurch technologisch mehr Spielraum. Die oft genannte Vorreiterrolle Deutschlands ist damit nicht falsch, aber sie blendet aus, dass wir durch unsere völkerrechtliche Bindung ein deutlich engeres regulatorisches Korsett tragen (Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste: Völker- und europarechtliche Vorgaben für das automatisierte Fahren, Bundesministerium für Verkehr: Bericht der Ethik-Kommission, Bundesministerium für Verkehr: Gesetz zum autonome Fahren tritt in Kraft, electrive.com: Germany to establish legal framework for remote-controlled vehicles) .
Zweitens, HMI heißt: Mensch-Maschine-Interaktion – nicht nur ein Interface. Wer bei SAE Level 4 oder Remote-Steuerung Verantwortung übernimmt, muss verstehen, was das System sieht, denkt und plant. KI kann dabei helfen, diese Transparenz herzustellen – durch adaptive, intuitive Rückmeldungen, die auch unter Stress verständlich bleiben. Nur mit verständlicher und intuitiver HMI können Anwender Vertrauen aufbauen – und bei Teleoperation live eingreifen, wenn nötig, wie bei Kupplung und Gaspedal, die heute intuitiv bedient werden – nicht, weil sie einfach sind, sondern weil ihre Logik verinnerlicht wurde. Genauso muss HMI für autonome Systeme gestaltet sein. Diese Schnittstelle ist entscheidend für eine vertrauenswürdige Fehlerkultur. Transparenz endet jedoch nicht an der Benutzeroberfläche. Sie beginnt bereits bei der Entwicklung selbst. Ich plädiere deshalb für eine Art ‚Eid des Asimovs‘ – eine ethische Selbstverpflichtung für Softwareentwickler und KI-Entwickler, vergleichbar mit dem Eid des Hippokrates in der Medizin. Sie würde nicht nur technische Sorgfalt einfordern, sondern auch die bewusste Verantwortung für die Auswirkungen maschineller Entscheidungen. Asimovs Robotergesetze (Britannica.com: three laws of robotics) waren Science-Fiction – aber der Gedanke, dass man Maschinen nicht ohne moralische Leitplanken bauen sollte, ist heute realer denn je.
Drittens, Lokalisierung & performante Datenübertragung: Autonome Systeme wie auch teleoperierte Fahrzeuge sind nur so gut wie ihre Infrastruktur. Ich nenne hier hochpräzise Lokalisierung via HD‑Karte, GNSS, SLAM, Ultra-low-latency Kommunikation (5G/6G, V2X) oder robuste Datenplattformen zur Echtzeitverarbeitung. Ohne zuverlässige, latenzarme Vernetzung samt präziser Positionsdaten bleibt autonomes Fahren – besonders Teleoperation – eine theoretische Vision. Wir müssen also nicht nur Vertrauen aufbauen – wir müssen auch ehrlich sagen, warum diese Technologie gebraucht wird. Es reicht nicht, Technik attraktiv darzustellen – wir müssen zeigen, wo sie gebraucht wird, weil ohne sie niemand mehr fährt. Dort entscheidet sich ihre gesellschaftliche Relevanz. Viertens, wirtschaftlicher und demografischer Druck – wir haben keine Wahl: Vertrauen ist wichtig, aber Notwendigkeit schafft Offenheit. In vielen Regionen fehlen heute bereits tausende Busfahrerinnen und Busfahrer (VDV: Personal- und Fachkräftebedarf im ÖPNV), vor allem im ländlichen Raum und im kommunalen Nahverkehr. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern weite Teile Europas. Der öffentliche Verkehr gerät dadurch unter Druck – und zwar nicht aus Mangel an Nachfrage, sondern aus Mangel an Personal. Autonomes oder teleoperiertes Fahren wird hier nicht zur Spielwiese, sondern zur notwendigen Infrastrukturmaßnahme, um überhaupt noch Mobilitätsangebote bereitstellen zu können – barrierefrei, flächendeckend und wirtschaftlich tragbar. Wenn Menschen spüren, dass autonome Fahrzeuge nicht als Ersatz, sondern als Ermöglicher gedacht sind – für ältere, mobilitätseingeschränkte oder auf dem Land lebende Menschen – dann wächst auch das Vertrauen. Notwendigkeit erzeugt Akzeptanz, wenn sie gut erklärt und verantwortungsvoll umgesetzt wird. Ein Blick nach Japan zeigt, dass man demografische Entwicklungen nicht ignorieren darf: Dort wird seit den 1960er-Jahren an technologischen Lösungen für eine alternde Gesellschaft gearbeitet. Autonomes Fahren wird dort nicht als Innovation vermarktet, sondern als gesellschaftliche Notwendigkeit verstanden – und genau das brauchen wir auch hier.
Motorjournalist: Vor vier Jahren hat Deutschland das autonome Fahren gesetzlich verankert. Danach ist der Einsatz von autonomen Fahrzeugen unter bestimmten Bedingungen und in festgelegten Betriebsbereichen erlaubt. Wie sieht es umgekehrt mit der Entwicklung autonomer Fahrzeuge in der Automobilindustrie bzw. generell in der Branche aus? Was tut sich hier?
Das geänderte Straßenverkehrsgesetz (StVG) erlaubt in § 1d den Einsatz von „Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen“, sofern bestimmte gesetzliche und verordnungsbasierte Voraussetzungen erfüllt sind. Dort heißt es wörtlich: „Ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion darf in einem festgelegten Betriebsbereich in den Verkehr gebracht werden, wenn die Voraussetzungen nach diesem Gesetz und der Verordnung nach § 1f erfüllt sind.“
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: § 1d StVG). Auffällig ist, dass hier bereits von „autonomer Fahrfunktion“ gesprochen wird – doch dieser Begriff unterscheidet sich wesentlich von der Definition des SAE Level 5. Laut SAE J3016_2021 bedeutet SAE Level 5 (Full Driving Automation):
„Sustained and unconditional performance by an ADS (automated driving system) of the entire DDT (dynamic driving task) without any expectation that a user will respond to a request to intervene. Please note that this performance, since it has no conditions to function, is not ODD (operational design domain)-specific.“ (American National Standards Institute: SAE Levels of Driving Automation). Der feine, aber fundamentale Unterschied: Während SAE Level 5 von bedingungsloser Autonomie unter allen Umwelt- und Verkehrsbedingungen ausgeht – also ohne jede Einschränkung durch eine „Operational Design Domain“ (ODD) und ohne Rückfallebene – erlaubt das StVG lediglich den Einsatz autonom genannter Fahrzeuge mit stark begrenztem Einsatzbereich und technischer Aufsicht. Die gesetzliche Autonomie in Deutschland ist damit faktisch auf SAE Level 4 beschränkt – also hochautomatisierte Systeme, die nur in vorher definierten Betriebsbereichen zugelassen sind und im Zweifel eine Remote-Supervision benötigen. Anders gesagt: Das Gesetz spricht von „autonom“, meint aber „hochautomatisiert“ – und überlässt es der Praxis, diese begriffliche Lücke durch Technik, Infrastruktur und Zulassungslogik zu überbrücken.

Abb.1: Die großen Sprünge kommen von Technologieunternehmen.
Die Lücke zwischen dieser juristischen Definition und der technischen Vision von vollautonomen Fahrzeugen bleibt damit bestehen – auch sprachlich. Die Industrie entwickelt hier mit Hochdruck – aber nicht immer synchron mit der Gesetzgebung. Deutschland hat sich rechtlich positioniert, doch technologisch dominieren derzeit Player, die weniger regulatorisch gebunden sind. Damit aus gesetzlichen Pilotmodellen industrielle Wirklichkeit wird, müssen KI, Infrastruktur und Zulassungspolitik enger verzahnt werden – und zwar international anschlussfähig. Was jetzt fehlt, sind international Standards – sowohl für die KI-Validierung als auch für die Kommunikation zwischen Fahrzeug, Infrastruktur und Leitstelle. Ohne solche Normen bleibt autonome Mobilität national limitiert und fragmentiert – dabei ist ihr Nutzen global. Man kann das gut am Schienenverkehr sehen: Lokomotiven und Züge müssen heute so gebaut sein, dass sie beim Passieren nationaler Grenzen automatisch auf unterschiedliche Signalsysteme, Stromspannungen oder Sicherheitsprotokolle reagieren können – ohne anzuhalten. Genau diese Art von technischer Interoperabilität brauchen wir auch im Straßenverkehr, wenn autonome Fahrzeuge grenzüberschreitend unterwegs sein sollen. Was tut sich in der Industrie? Die Automobilindustrie und Forschungsinitiativen des Bundes haben in den vergangenen Jahren massiv in autonome Technologien investiert, besonders in Sensorik (Lidar, Radar, Kamera und Fusion, z.B. Projekt Projekt Bundesministerium für Bildung und Forschung: Deutsch-japanische Forschungskooperation im automatisierten und vernetzten Fahren: Virtuelle Validierung), Hochleistungsrechner & KI-Modelle, Simulations- & Absicherungsmethoden (z.B. Projekte wie PEGASUS – Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktionen, VVMethoden – Verifikations- und Validierungsmethoden automatisierter Fahrzeuge Level 4 und 5 , SET Level 4to5 – Simulationsbasiertes Entwickeln und Testen von Level 4 und 5 Systemen) oder auch Teleoperation & Remote Control-Systeme. Hersteller wie Mercedes-Benz (z. B. Drive Pilot für SAE Level 3 oder – vom Automobilclub KS e.V. in 2023 gewürdigte – Fahrerloses Bosch Parksystem: mehr als Parken sowie INTELLIGENT PARK PILOT mit SAE Level 4 in Parkhäusern), Volkswagen, BMW, aber auch Zulieferer wie Bosch, ZF und Continental arbeiten an skalierbaren Lösungen. Bosch etwa reagiert aktuell mit Hochdruck auf Entwicklungen wie BYDs „God’s Eye“ – ein 360°-Rundumsystem, das zeigt, wie ernst der Innovationsdruck aus China inzwischen geworden ist. Gleichzeitig tritt immer deutlicher hervor: Die großen Sprünge kommen heute weniger aus der Autoindustrie, sondern von Technologieunternehmen.
Waymo, ehemals unter John Krafcik, hat das treffend formuliert: „Wir entwickeln keinen Wagen – wir entwickeln den Fahrer.“ (twice.com: Waymo Isn’t Building Cars; It’s Building Drivers). Das zeigt die strategische Verschiebung: Autonomes Fahren ist weniger Produkt- als Systementwicklung, bei der Software, KI und Infrastruktur den Ausschlag geben. Was bedeutet das für die Gesetzgebung? Gesetzgebung und Technik müssen synchronisiert werden. Doch das bleibt schwierig. Die deutsche Gesetzgebung wirkt deshalb teilweise ambitioniert – aber auch artifiziell, weil sie komplexe Rückversicherungssysteme einfordert (z. B. Remote-Supervision, Datenprotokolle), die andernorts nicht notwendig sind. Hinzu kommt: Deutschland steht als Unterzeichnerstaat der Wiener Straßenverkehrskonvention (1968) vor einer juristischen Ausgangslage, die Länder wie die USA oder Japan gar nicht betrifft. Dort gibt es keine gesetzliche Pflicht zur menschlichen Fahrverantwortung – autonome Systeme lassen sich dort einfacher, aber mit weniger Absicherung umsetzen. Eine echte Fortentwicklung der Gesetzgebung muss daher zwei Dinge leisten: Erstens, Regelwerke vereinfachen ohne auf Sicherheit zu verzichten und zweitens Zulassungsverfahren schaffen, die auch KI-basierte Entscheidungslogik nachvollziehbar und auditierbar machen – also KI-Absicherung.
Motorjournalist: Sie sagten zuvor, autonom fahrende Autos sind mehr als Wunschdenken. Vielmehr seien sie angesichts des wirtschaftlichen und demographischen Drucks ein Muss. Macht diese Art der Mobilität überhaupt langfristig Sinn und wenn ja, warum? Welche Vorteile sehen Sie darin konkret für eine nachhaltige, barrierefreie und sozial gerechte Mobilität der Zukunft?
Prof. Schneider: Autonomes Fahren ist in der Tat kein Wunschdenken, aber auch kein Selbstläufer. Es wird Realität, wenn Zulassungsrecht, Technik und Mensch zusammenfinden. Die Autoindustrie ist dabei nicht nur Fahrzeughersteller, sondern oft Komponentenbeschleuniger. Sie liefert günstige, robuste Sensorik und Software, die in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft Nutzen entfalten können. Autonomie kann so zu einem Treiber für gerechtere, zugänglichere und nachhaltigere Mobilität werden – vorausgesetzt wir regulieren jetzt klug, testen konsequent und kommunizieren offen. Aktuell sind viele Funktionen, die fälschlich als ‚autonom‘ bezeichnet werden, in Wahrheit Assistenzsysteme (SAE Level 2) (bekannt ist hier die Diskussion um die ambitionierte Namensgebung von Teslas „Autopilot“, der ein SAE Level 2 System ist) oder bestenfalls bedingt automatisierte Systeme (SAE Level 3 und 4). Für echte Autonomie (SAE Level 5) braucht es weit mehr als nur Technologie: Es braucht Regulierung, Infrastruktur und gesellschaftliche Akzeptanz.
Die Vision autonomer Mobilität ist sozial und ökologisch sinnvoll. So ist sie barrierefrei, denn sie bietet Mobilität für Menschen mit Einschränkungen, Senioren, Kinder – ohne auf eigenes Auto oder Fahrer angewiesen zu sein. Sie ist sozial gerecht, da On-Demand-Shuttles oder autonome Zubringer Regionen erschließen können, in denen heute kein ÖPNV fährt. Zudem ist sie nachhaltig, denn autonome Systeme ermöglichen eine effizientere Nutzung von Fahrzeugflotten, weniger Leerfahrten, optimierte Routen – und damit weniger Energieverbrauch. Und: autonome Mobilität steht für Wirtschaftlichkeit, denn es fehlen Fahrerinnen und Fahrer. Last, but not least hinzu kommt ein oft unterschätzter Aspekt: Autonomie ist nicht auf Autos beschränkt. Ob autonome Kehrmaschine, landwirtschaftliche Erntemaschine oder Logistikfahrzeug – die darunterliegende Technologie schafft Lösungen für völlig unterschiedliche gesellschaftliche Anforderungen. Dazu habe ich zusammen mit einem Kollegen, Dr. Jürgen Stübner, bereits im April 2018 auf meinem Kooperationsforum: TechROAD Autonome eBusse: TechROAD Bad Birnbach am 10. April 2018 und Interview) eine Erweiterung der sechs SAE Level vorgeschlagen: Level 6 geführte autonome Systeme, Level 7 dirigierte autonome Systeme, Level 8 selbstorganisierte Gruppen und Level 9 Selbstorganisierte Schwärme (Expanding the scale of definition levels of autonomous driving).

Abb. 2: Fortschritt bleibt fragil: Der autonome e-Bus in Bad Birnbach ist Geschichte.
Nebenbei bemerkt: Mit dem autonomen eBus in Bad Birnbach sorgte die Deutsche Bahn ab Oktober 2017 für mehr positive Schlagzeilen als mit ihrem klassischen Kerngeschäft – ein starkes Symbol für Innovationsbereitschaft im ländlichen Raum. Nach mehr als sieben Jahren Pilotbetrieb wurde das Projekt jedoch zum 31. Dezember 2024 eingestellt, weil sich der Hersteller EasyMile aus der Personenbeförderung zurückzieht. Gerade weil es als europäisches Vorzeigeprojekt galt, ist das Ende umso bedauerlicher – es zeigt, wie fragil Fortschritt bleibt, wenn die technische und wirtschaftliche Verstetigung nicht mitwächst. Fortsetzung folgt.
Das Interview mit Prof. Schneider führte Isabella Finsterwalder, Porträtbild Prof. Stefan-Alexander Schneider, Quelle: privat, und Abbildung Level autonomes Fahren, Quelle: HS Kempten; weitere Abbildungen: Pixabay
Kasten 1
Erläuterung zu SAE und Level 0 bis 5
SAE steht für die Society of Automotive Engineers, eine US-amerikanische, globale Organisation für Ingenieurstandards, insbesondere in den Bereichen Automobiltechnik, Luftfahrt und Mobilitätssysteme. SAE definiert technische Standards, die international als Referenz gelten – von Fahrzeugtechnik über Kraftstoffe bis zur Systemintegration. Das schafft Vergleichbarkeit, Kompatibilität und Sicherheit in der Entwicklung.
SAE-J3016 – das Referenzmodell für automatisiertes Fahren:
Level 0: Keine Automatisierung – Mensch fährt
Level 1: Fahrerassistenz (z. B. Tempomat) – Mensch überwacht
Level 2: Teilautomatisiert (z. B. Spurhalte + ACC) – Mensch bleibt verantwortlich
Level 3: Bedingt automatisiert (z. B. Staupilot) – Mensch kann Hände wegnehmen, muss aber eingreifen können
Level 4: Hochautomatisiert – Kein Fahrer nötig – aber nur in definierten Bereichen
Level 5: Vollautomatisiert – Kein Fahrer nötig – unter allen Bedingungen
Diese sechs Level sind heute globaler Standard für Industrie, Gesetzgeber und Öffentlichkeit.
Kasten 2
Prof. Schneider bringt autonomes Fahren auf den Punkt:
Autonomes Fahren ist weit mehr als ein technologisches Entwicklungsziel. Es ist ein Spiegel dafür, wie wir als Gesellschaft mit Komplexität, Unsicherheit und Verantwortung umgehen. Wir bauen keine Maschinen, die einfach nur schneller oder bequemer sind. Wir bauen Systeme, die Entscheidungen treffen – und dafür müssen wir sie so gestalten, dass sie sich selbst einschätzen, erklären und begrenzen können. Science-Fiction-Filme wie Ex Machina (2014, Regie: Alex Garland) erinnern uns eindrücklich daran, dass technische Intelligenz ohne ein moralisches Koordinatensystem zur Blackbox werden kann. Die Frage ist daher nicht nur: Können wir Maschinen bauen, die handeln? Sondern: Können wir ihnen beibringen, ihre Grenzen zu erkennen – und dem Menschen gegenüber transparent zu bleiben? Das ist keine Schwäche, sondern ein Ausdruck von Reife – technisch wie gesellschaftlich. Wir stehen am Beginn eines Zeitalters, in dem Mensch und Maschine nicht gegeneinander, sondern miteinander mobil werden. Wenn uns das gelingt – durch verlässliche Architektur aus Verantwortung und Transparenz, durch nachvollziehbare Technik und durch eine Kultur des Fragens statt Überlassens –, dann kann autonomes Fahren wirklich ein Baustein für eine gerechtere, zugänglichere und verantwortliche Mobilität werden.
Kasten 3
Vita Prof. Dr. rer. nat. Stefan Alexander Schneider:
Prof. Dr. Stefan-Alexander Schneider ist Professor für das Fachgebiet Fahrerassistenzsysteme an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten. Sein akademischer Hintergrund liegt in der Mathematik – und damit im exakten Denken innerhalb komplexer Systeme. Zuvor war er viele Jahre in der Entwicklung und Forschung in der Automobilindustrie tätig – unter anderem bei BMW im Bereich Softwarequalifizierung sowie in der Simulation von Gesamtfahrzeugen. Dabei arbeitete er an der Schnittstelle zwischen industrieller Praxis, Sicherheitsnachweis und digitaler Systementwicklung. Neben der starken regionalen Anwendungsorientierung in Lehre und Transfer liegt ihm der internationale wissenschaftliche Austausch besonders am Herzen: Seit mehr als zehn Jahren ist er Gastprofessor am Shibaura Institute of Technology in Tokio, Japan. Darüber hinaus engagiert sich Prof. Schneider als Kurator des Deutschen Museums für die Vermittlung von Technikgeschichte und deren Brücke in die Zukunft.