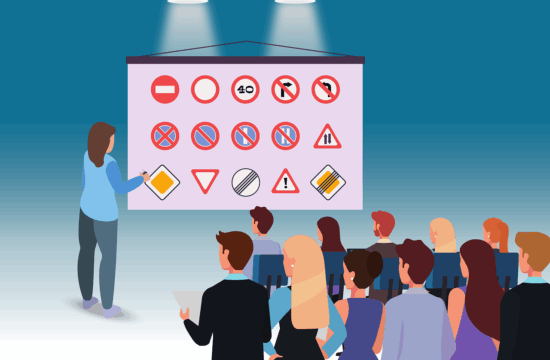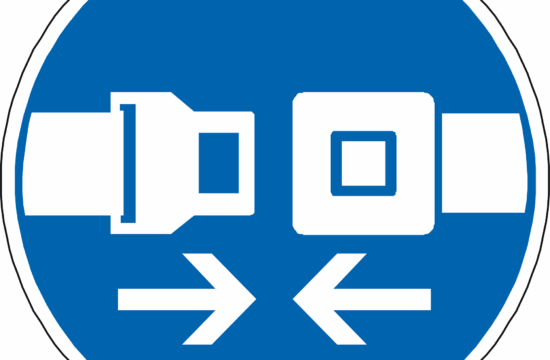Bereits im Mai hatten wir kurz über den neusten DEKRA Verkehrssicherheitsreport berichtet. Nun hat sich unser Kolumnist noch intensiver mit dem Werk beschäftigt. Hier seine Einschätzung.

Alljährlich legt die DEKRA ihren akribisch erarbeiteten Verkehrssicherheitsreport vor und macht auf die aus Sicht der weltweit im Dienst der Verkehrssicherheit tätigen Organisation wichtigsten Sicherheitsprobleme in Deutschland und Europa aufmerksam. Alle mit dem Ziel einer Steigerung der Verkehrssicherheit tätigen Organisationen, aber auch der Staat mit seinen verschiedenen Institutionen, tun gut daran, das Statement der DEKRA nicht nur aufmerksam zu lesen, sondern auch die darin von Expertinnen und Experten geäußerten Gedanken aufzunehmen und in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu steigern.
I. Internationaler Ansatz
Wer Fortschritte für die Verkehrssicherheit erreichen will, muss international denken. Das ist ein Grundgedanke der DEKRA. Deutschland ist mit seinem Straßensystem eingebunden in das europäische Verkehrsnetz und ist ein typisches Transitland, dessen Verkehrswege von zahlreichen Fahrerinnen und Fahrern beruflich wie auch privat mit Zielorten in Deutschland und anderswo in Europa genutzt werden. Genau vor diesem Hintergrund sind im DEKRA-Verkehrssicherheitsreport regelmäßig auch europäische Autoren vertreten, in diesem Jahr der EU-Koordinator für Straßenverkehrssicherheit, Kristian Schmidt, der Executive Director des European Transport Safety Council, Antonio Avenoso, sowie auch der Erste Vizepräsident des Ausschusses für Verkehrssicherheit des Abgeordnetenhauses des spanischen Parlaments, Juan Carlos jerez Antequera. Ihre Geleitworte sind den fachlichen Inhalten bewusst vorangestellt worden, beinhalten aber auch bereits engagierte Statements für die Verkehrssicherheit.
Die persönliche Einleitung in den Report wird komplettiert durch ein pointiertes Statement der Präsidentin der Deutschen Verkehrswacht, Kirsten Lühmann, einer ausgewiesenen Fachfrau für die Belange der Verkehrssicherheit sowie des nicht minder engagierten Präsidenten des DVR, Manfred Wirsch, der insbesondere die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen DEKRA und DVR betont.
Stringent setzen die Autoren des Reports mit einem Überblick über die aktuellen statistischen Zahlen zur Verkehrssicherheit und dem unter dem weltweiten Blickwinkel der WHO präsentierten Unfallgeschehen fort und geben den Leserinnen und Lesern dadurch eine stabile Faktengrundlage für die Interpretation der nachfolgenden Fachbeiträge. Besonders sticht dabei das Kapitel „Meilensteine der Verkehrssicherheit in ausgewählten Ländern“ heraus, weil unter dem Aspekt des Best Practice stets jeder Staat von den Erfolgen für die Verkehrssicherheit in den anderen Staaten lernen sollte; denn nur auf diese dynamische Weise kann der weltweite Ansatz der Vision Zero an Fahrt gewinnen und konkrete Erfolge zeitigen. Dass dieses vergleichende Benchmark-Konzept nicht einmal in Deutschland zwischen den 16 Bundesländern und dem Bund konsequent praktiziert wird, macht den Ansatz der DEKRA umso wichtiger.
Besonders bemerkenswert sind dabei die folgenden in der Vergangenheit von großen Erfolgen für die Verkehrssicherheit gekrönten Maßnahmen in den von der DEKRA ausgewählten Vergleichsländern:
• Frankreich: Tempolimit 130 km/h auf Autobahnen (eingeführt 1974)
• Schweden: Absenkung Promillegrenze für Trunkenheit am Steuer auf 0,2 Promille Blutalkoholkonzentration (1990)
• Spanien: Verdoppelung der Punktzahl für Handynutzung am Steuer von 3 auf 6 Punkte (2022)
• United Kingdom: Tempolimit 70 mp/h (113 km/h) auf Autobahnen (eingeführt 1978)
• Japan: Absenkung Promillegrenze für Trunkenheit am Steuer auf 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration (1999)
• Australien: Verpflichtende Teilnahme an Alkoholtests (ab 1976)
Zahlreiche weitere internationale Statements bekannter Verkehrssicherheitsexperten unter anderem aus Polen, Italien, Portugal und den USA, komplettieren den internationalen Ansatz des Reports.
II. Einzelprobleme
Unfallanalytische Betrachtungen von Baumunfällen, Kollisionen zwischen Pkw und Fußgängern, zwischen Lkw und Radfahrern sowie zwischen Lkw im Längsverkehr lenken den Blick auf eine sorgfältige Verkehrsunfallaufnahme und -analyse, um strukturelle Probleme besser erkennen und mit angemessenen Maßnahmen adäquat reagieren zu können. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) legt seit vielen Jahren großen Wert auf eine Steigerung in der fachlichen Qualität der Verkehrsunfallaufnahme und stellt in diesem Zusammenhang besonders gelungene Beispiele fachlich guter Polizeiarbeit wie zum Beispiel die vorbildliche Arbeit in den Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei in NRW besonders heraus.
Das folgende Kapitel im Report widmet sich mit zahlreichen Beiträgen dem „Faktor Mensch“.
Eine Betrachtung des Genusses von Cannabis als Einzelproblematik des berauschten Fahrens lenkt den Blick auf ein insbesondere in Deutschland aktuell bestehendes Problem, das durch die Teil-Legalisierung dieses Rauschmittels eine erneute Steigerung erfahren hat. Die Betrachtung dieses Rauschmittels wird fachlich kongenial ergänzt durch die nachfolgende Problembeschreibung des Alkoholkonsums als traditionell fortbestehenden Störfaktor der Verkehrssicherheit über sämtliche Staatsgrenzen hinaus und wird sinnvoll fortgeführt durch einen ersten Einblick in die Verkehrspsychologie als wirksames Interventionsmodell zur positiven Veränderung fehlerhaften Verkehrsverhaltens.
Die Erfassung von Kennzahlen zur Straßenverkehrssicherheit durch das „KPI-Projekt“ (KPI steht für Key Performance Indicator) ist ein übergreifender und erst seit 2020 von der EU initiierter Ansatz, der es ermöglicht, grundsätzlich die Messung der Fortschritte der verschiedenen Staaten im Laufe der Zeit und deren Bewertung der Wirksamkeit umgesetzter Maßnahmen und Initiativen zu erreichen. Dies soll durch die Erfassung und Auswertung der folgenden acht Marker angestrebt werden:
• Geschwindigkeit,
• Sicherheitsgurt und Kinderrückhaltesysteme,
• Schutzhelme,
• Alkohol,
• Ablenkung,
• Fahrzeugsicherheit,
• Infrastruktur und
• Betreuung nach einem Unfall.
Mit weiteren Beiträgen greifen die Autoren des Reports in diesem Kapitel die aktuellen Themen des vernetzten Fahrens, des teleoperierten Fahrens sowie der Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Fahrzeugbetrieb auf, ehe im Folgekapitel die Fahrzeug- und Verkehrstechnik beleuchtet werden. Insbesondere das teleoperierte Fahren, also das Fernsteuern beispielsweise von Car-Sharing-Autos zu den Kunden oder zu den reservierten Parkplätzen, birgt in der Person des Teleoperators liegende Gefahren wie eine zu späte Anpassung an des Situationsbewusstseins oder Fehleinschätzungen von Verkehrssituationen. Zudem können Latenzzeiten zwischen dem Signaleingang beim Teleoperator und dessen Reaktion so zeitkritisch sein, dass eine rechtzeitige Reaktion auf ein notwendiges Fahrmanöver nicht gewährleistet werden kann. Angesichts dieser Gefahren muss das Inkrafttreten der Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für ferngelenkte Kraftfahrzeuge (Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung – StVFernLV) zum 1.12.2025 als gewagt angesehen werden.
Im Kapitel „Technik“ steht zunächst das Zusammenspiel von passiven und aktiven Sicherheitssystemen im Fahrzeug im Fokus, wobei ein hilfreicher Überblick über die wichtigsten, aber dennoch sehr zahlreichen Fahrerassistenzsysteme und ihre Funktionsweise das technische Verständnis der Leserinnen und Leser erheblich erleichtert. Dass Microcars bei der Verkehrssicherheit ihrer Insassen besonders schlecht abschneiden ist ein Hinweis der Unfallforscher der DEKRA, der – bei allem Verständnis für die Vorteile der Nutzung dieser Minikraftfahrzeuge bei der innerstädtischen Parkplatzsuche – deutlich zu denken geben sollte.
Besonders bemerkenswert ist vor dem Hintergrund weiterhin steigernder aktueller Verkaufstrends von SUV in Deutschland eine Betrachtung der Verletzungsfolgen für Fußgänger bei Kollisionen mit SUV. Zu Recht macht die DEKRA darauf aufmerksam, dass insbesondere bei einer typischen Front großer SUVs mit einer Höhe der Motorhaubenvorderkante von mehr als 100 Zentimetern die Verletzungs- und Tötungsrisiken für Fußgänger enorm steigen.
III. Fazit
In einem abschließenden Statement widmet sich die DEKRA der Vision Zero und fordert von der Politik eindringlich, dass die ehrgeizigen Ziele der Vision Zero nur durch ein kontinuierliches Engagement aller Beteiligten mittels konkreter Maßnahmen und möglicherweise auch einem neuen Verständnis von Mobilität erreicht werden können.
Der Report schließt dann auch folgerichtig mit den aktuellen „Forderungen der DEKRA für mehr Verkehrssicherheit“:
1. Der Straßenverkehr ist als soziales Miteinander zu verstehen und erfordert somit ein verantwortungsbewusstes, regelgerechtes und partnerschaftliches Verhalten aller Verkehrsteilnehmenden.
2. Die Verfügbarkeit fundierter und weitestgehend vergleichbarer Unfalldaten und Statistiken muss national und international weiter verbessert werden.
3. Insbesondere auch in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen müssen die Anstrengungen für mehr Verkehrssicherheit verstärkt werden.
4. Die Verkehrssicherheitsarbeit muss sich neben der Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten auch noch stärker darauf konzentrieren, die Zahl der Schwerverletzten zu senken.
5. Vor der Umsetzung einer anderswo nachweislich erfolgreichen Verkehrssicherheitsmaßnahme ist genau zu prüfen, ob sie auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort übertragbar und somit ebenfalls erfolgreich anwendbar ist.
6. Besonders gefährliche Verhaltensweisen wie Alkohol und Drogen am Steuer, Ablenkung etwa durch das Smartphone oder übermäßige Geschwindigkeitsüberschreitungen müssen konsequent verboten, kontrolliert und wirksam geahndet werden.
7. Der Sicherheitsgurt als Lebensretter Nummer eins ist bei jeder Fahrt auf allen damit ausgerüsteten Sitzen anzulegen, Kinder sind größen- und altersgerecht zu sichern.
8. Aufsassen von motorisierten und nicht motorisierten Zweirädern sollten immer einen geeigneten Helm tragen – unabhängig davon, ob er im jeweiligen Rechtsrahmen vorgeschrieben ist oder nicht.
9. Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern sollten sich vor der erstmaligen Teilnahme am Straßenverkehr mit den spezifischen Verkehrsregeln vertraut machen und den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug unter kontrollierten Bedingungen üben.
10. Wer Zweiräder nutzt, muss sich bewusst sein, wie wichtig aktive und passive Beleuchtungseinrichtungen für die Sicherheit sind, und die Fahrzeuge entsprechend ausrüsten.
11. Die sorgfältige Anlage, Instandhaltung und die Pflege von Rad- und Fußwegen sind für einen sicheren Fahrrad- und Fußgängerverkehr unerlässlich.
12. Eine kontinuierliche Verkehrserziehung ist die beste Prävention – sie sollte daher so früh wie möglich beginnen, alle Gruppen von Verkehrsteilnehmenden differenziert ansprechen und bis ins hohe Alter reichen.
13. Bereits während der Fahrausbildung sollten der Umgang mit Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen vermittelt, aber auch die Grenzen dieser Systeme deutlich gemacht werden. Im Idealfall sollte der sichere Umgang mit diesen Systemen Teil der Fahrerlaubnisprüfung sein.
14. Die Funktionsfähigkeit mechanischer und elektronischer Komponenten von Systemen der Fahrzeugsicherheit muss über das gesamte Fahrzeugleben hinweg gewährleistet sein. Das gilt auch für den Aspekt der Cyber-Sicherheit. Die Inhalte der periodischen Überwachung von Kraftfahrzeugen sind entsprechend regelmäßig anzupassen. Darüber hinaus benötigen die Prüforganisationen einen geregelten Zugang zu den originären sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten.
15. Beim Neubau insbesondere von Landstraßen oder bei entsprechenden straßenbaulichen Veränderungen muss das oberste Ziel die selbsterklärende Straße mit fehlerverzeihender Seitenraumgestaltung sein. Bestehende Bäume im unmittelbaren Straßenseitenraum sollten mit Schutzeinrichtungen versehen werden, Neupflanzungen sollten nur mit genügender Entfernung zum Straßenrand erfolgen.
Man kann für die Zukunft nur darauf hoffen, dass die guten und für die Steigerung der Verkehrssicherheit sehr wichtigen Gedanken aus dem DEKRA-Verkehrssicherheitsreport 2025 von den Verkehrspolitikern und Innenpolitikern aufgegriffen werden und in konkrete Gesetze und Verordnungen umgesetzt werden. Leider muss man jedoch aus heutiger Sicht konstatieren, dass die DEKRA mit ihrem enormen Fachwissen im Verkehrsbereich nicht einmal zu den Organisationen zählt, die im Rahmen von Novellierungen des Verkehrsrechts von den betreffenden Bundesministerien angehört werden. Auch dieser negative Umstand muss uns im Sinne eines am Grundgedanken der Vision Zero orientierten Bundesgesetzgebers und eines Bundesministeriums für Verkehr zu denken geben.
Weiterführende Links
Download DEKRA-Verkehrssicherheitsreport 2025
hier klicken
Download zur polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme
hier klicken
StVFernLV im Bundesgesetzblatt
hier klicken
Müllers Kolumne Ferngelenkte Autos
hier klicken
Professor Dr. Dieter Müller ist Verkehrsrechtsexperte und Träger des Goldenen Dieselrings des VdM. An der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) lehrt er Straßenverkehrsrecht mit Verkehrsstrafrecht. Zudem ist er Gründer und Leiter des IVV Instituts für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten sowie unter anderem Vorsitzender des juristischen Beirats des DVR. An dieser Stelle kommentiert der Fachmann Aktuelles zu Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und Verkehrspolitik.
Fotos: DEKRA