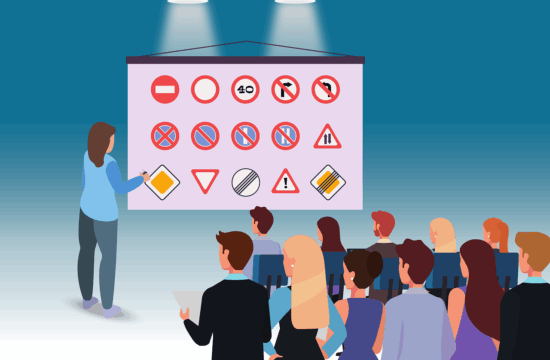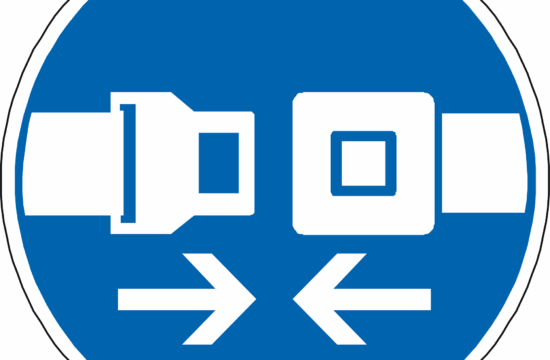In den Niederlanden ist der sogenannte „Handyblitzer“ schon seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Er detektiert Handyverstöße am Steuer, die daraufhin im schriftlichen Verfahren geahndet werden können. Als bisher einziges Bundesland hat Rheinland-Pfalz diese neue Überwachungstechnik 2022 praktisch erprobt und nun auch im landeseigenen Polizeirecht gesetzlich verankert. Die Neuregelung gilt seit dem 1. März 2025.
Begriffsklärung der „Monocam“
Das System der „Monocam“ besteht aus einer Kamera und einer Software auf einem PC. Diese Kombination aus Kamera und Software arbeitet ähnlich wie ein Abstandsüberwachungssystem. Bei beiden Systemen handelt es sich um einen sogenannten „aufmerksamen Messbetrieb“, das heißt es ist immer ein Polizeibeamter oder ein angestellter Bediensteter der Polizei dabei.
Dabei wird der Verkehrsfluss aus einer erhöhten Position – wie etwa von einer Autobahnbrücke – beobachtet. Bereits während der Videoaufnahme analysiert die Software in Echtzeit, ob ein Fahrzeugführer ein Handy in der Hand hält. Wenn das System aufgrund seiner einprogrammierten vergleichbaren Verhaltensweisen früherer Aufnahmen einen Verstoß erkennt, werden die Aufnahmen als Beweise gespeichert. Errechnet das System keinen Verstoß, werden die betreffenden Sequenzen sofort und rückstandsfrei gelöscht. Insofern ist das System vergleichbar mit dem vor einiger Zeit in Niedersachsen im Einsatz gewesenen System „Section Control“, mit dessen Hilfe Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einem bestimmten Streckenabschnitt errechnet werden konnten. Wenn aber ein Verstoß vom System festgestellt wird, muss die betreffende Videosequenz sofort von einem Polizeibeamten an einem Bildschirm überprüft und damit verifiziert werden. Bestätigt sich der Verstoß der immer noch weiter „lernenden Software“ nicht, muss der Polizeibeamte die betreffende Videosequenz sofort auf eine Weise löschen, dass die Aufnahme nicht wiederhergestellt werden kann.
Kampf gegen die Unfallursache „Ablenkung“
Die Unfallursache „Ablenkung“ basiert zu großen Teilen auf der verbotenen Handynutzung durch Autofahrer. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert nach der Grundregel des § 1 Abs. 1 StVO „ständige Vorsicht“, sodass Autofahrer, die sich durch ihr Smartphone – gleich welcher Funktion der Bedienung – ablenken lassen, die zentrale Grundregel des Verkehrsrechts missachten. Dass insbesondere die Ablenkung durch Smartphone-Nutzung ein hohes Unfallrisiko mit sich bringt, hat die Unfallforschung der Deutschen Versicherer schon vor einigen Jahren durch mehrere einschlägige Forschungsprojekte in verdienstvoller Weise bewiesen. Wenn die Nutzung eines Smartphones durch Überwachungstechnik erkannt und Verstöße nachfolgend geahndet werden können, bestehen also gute Chancen, einen Beitrag zur Anhebung der Verkehrssicherheit zu leisten.
Die zentrale Norm des § 23 Abs. 1a StVO
Wer ein Fahrzeug führt, darf nach dieser Verbotsnorm ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist nicht benutzen, wenn er es zur Bedienung aufnimmt oder bereits in der Hand hält.
Verstöße gegen diese Norm können nicht fahrlässig begangen werden, sondern werden immer bewusst, also vorsätzlich begangen, weil niemand „aus Versehen“ telefoniert, textet oder eine andere Funktion des elektronischen Geräts nutzt.
Übrigens ist die Bezeichnung „Handyblitzer“ nicht nur missverständlich, sondern sachlich sogar falsch, weil auch die Bedienung anderer elektronischer Geräte wie zum Beispiel Taschenrechner, Diktiergeräte, Scanner und so weiter den Verbotstatbestand erfüllen und dessen Rechtsfolgen auslösen.
Die erste und bekannteste Rechtsfolge ist das Bußgeld von 100 Euro, das in Anbetracht der vorsätzlichen Tathandlung und der potenziellen Gefährlichkeit dieser Unfallursache deutlich zu gering bemessen ist; denn Unfallforscher setzen die Gefährlichkeit des Verstoßes mit dem Verstoß gegen die 0,5-Promille-Regelung des § 24a Abs. 1 StVG gleich und dafür ist ein Bußgeld von 500 Euro bei einem fahrlässigen Verstoß fällig.
Hinzu tritt beim „Handyverstoß“ ein Punkt im Fahreignungsregister („Punkteregister“), während es beim Promilleverstoß zwei Punkte sind. Ein Fahrverbot hat der Handysünder nur im Wiederholungsfall und auch dann nur ausnahmsweise zu erwarten, während der Promilletäter ein Regelfahrverbot von einem Monat erhält.
Hier besteht also für den neuen Verkehrsminister Handlungsbedarf, wenn er diese Unfallursache ernst nimmt.
Schon heute sind aber Erhöhungen des Bußgeldes von 100 Euro auf den doppelten und dreifachen Betrag möglich, wenn er in seinem Auto Fahrgäste transportiert und dadurch deren Sicherheit ebenfalls potenziell gefährdet. Rechtsgrundlage für eine solche Erhöhung ist die in vielen Bußgeldbehörden leider noch unbekannte und daher fast nie angewendete Bußgeldvorschrift des § 17 Abs. 3 OWiG.
Die neue Rechtsnorm
Die Neuregelung in § 30 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz lautet:
(8) Die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum zur Verhütung der unerlaubten Benutzung von elektronischen Geräten im Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils geltenden Fassung personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Bildübertragung und Bildaufzeichnung erheben. Die Bildaufzeichnungen dürfen das Fahrzeug, die Fahrzeuginsassen, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrtrichtung sowie Zeit und Ort erfassen und mit Hilfe intelligenter Videotechnik auf der Fahrerseite ausgewertet werden. Sie sind unverzüglich automatisiert zu löschen, wenn das technische Mittel keine unerlaubte Benutzung eines elektronischen Gerätes im Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils geltenden Fassung feststellt. Stellt das technische Mittel einen Verstoß fest, ist unverzüglich zu überprüfen, ob dieser bestätigt werden kann; ist dies nicht der Fall, sind die aufgezeichneten Daten sofort und spurenlos zu löschen. Aufgezeichnete Daten, die nicht sofort gelöscht werden, dürfen ausschließlich zum Zweck der Verfolgung und Ahndung der unerlaubten Benutzung von elektronischen Geräten im Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verarbeitet werden. Die Verkehrsüberwachungsmaßnahme ist kenntlich zu machen. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.
Die rechtlichen Voraussetzungen des Einsatzes der neuen Videomesstechnik sind also folgende:
• Nutzung nur auf öffentlichen Straßen,
• beschränkte Nutzung nur zur Verhütung der unerlaubten Benutzung von elektronischen Geräten im Sinne des § 23 Abs. 1a StVO,
• Anfertigung von Bildaufzeichnungen,
• Erfassen von Fahrzeuginsassen, Fahrzeugkennzeichen, Fahrtrichtung, Zeit und Ort,
• Auswertung der Videos nur auf der Fahrerseite.
Die Pflichten der Polizei und Bußgeldbehörde sind:
• Kenntlichmachen der Verkehrsüberwachung (erfolgt üblicherweise durch ein Verkehrsschild),
• unverzügliche automatisierte Löschung aufgezeichneter Daten, wenn kein Verstoß festgestellt wurde,
• unverzügliche Prüfung (durch einen Polizeibeamten vor Ort der Messung), ob festgestellte Verstöße bestätigt werden können,
• im Falle der Nichtbestätigung sofortige und spurenlose Löschung der aufgezeichneten Daten,
• Datenverarbeitung aufgezeichneter Daten nur zum Zweck der Verfolgung und Ahndung festgestellter Delikte.
Die Erfahrung der früheren Anwendung der erfolgreichen Messtechnik „Section Control“ (die Technik wurde inzwischen aus verwaltungsinternen Gründen aufgegeben und abgebaut) aus Niedersachsen lehrt, dass sich Verkehrssünder vor den zuständigen Bußgeldbehörden und Amtsgerichten juristisch wehren werden, was ihr gutes Recht ist. Jedoch sind ihre Chancen äußerst gering, weil die niedersächsische Rechtsvorschrift bis hin zum Bundesverwaltungsgericht als rechtmäßig angesehen und nachfolgend vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde. Genauso wird auch die rheinland-pfälzische Neuregelung vor den Gerichten bestehen.
Eine praktische Schwäche dieser Rechtskonstruktion liegt in der Begrenzung der Anwendung auf die Polizei, sodass nach dem Wortsinn der Vorschrift die Kommunen mit ihrer kommunalen Verkehrsüberwachung die neue Messtechnik nicht anwenden dürften. Das hätte der Gesetzgeber klarer fassen können; denn es wäre überaus sinnvoll, wenn Polizei und Kommunen die neue Messtechnik gleichermaßen nutzen dürfte, um einen für die Verkehrssicherheit dienlichen „Flächendruck“ erreichen zu können.
Die Reaktion des ADAC
Reflexartig bezieht der weltweit größte Automobilclub Stellung gegen die neue Überwachungstechnik und vermutet Verstöße gegen den Datenschutz, und dies, obwohl durch die neue Vorschrift juristisch sichergestellt ist, dass Videos von der Software sofort rückstandslos und nicht wiederherstellbar gelöscht werden, wenn kein Verstoß errechnet wurde. Durch diese Vermutung betreibt der ADAC eine generelle Verunsicherung seiner Mitglieder und der Öffentlichkeit, die sicherlich allesamt nicht von einem durch ein Smartphone abgelenkten Autofahrer über den Haufen gefahren werden wollen. Hier könnte der größte deutsche Automobilclub einmal echte Größe beweisen und sich auf die Seite der Verkehrssicherheit stellen.
Fazit
Die neue Verkehrsüberwachungstechnik zur Feststellung von „Handyverstößen“ wird schnell erste Erfolge zeigen, weil zahlreiche Handysünder entdeckt und ihr Fehlverhalten geahndet werden wird. Die Ahndung erfolgt leider nur mit 100 Euro und einem Punkt, was bei vielen Autofahrern ein Umdenken vermissen lassen dürfte.
Da das erfolgversprechende Projekt zur Steigerung der Verkehrssicherheit nur auf das Bundesland Rheinland-Pfalz beschränkt ist, profitieren die Bürgerinnen und Bürger in anderen Bundesländern nicht von diesem potenziellen Sicherheitsgewinn, weil deren Innenministerien zu zaghaft gegen die gefährlichen Verkehrssünder vorgehen.
Es bleibt nur zu wünschen, dass sich alle 15 anderen Bundesländer die zu erwartenden Erfolge ihrer Kollegen aus Rheinland-Pfalz bald zu eigen machen werden – die Steigerung der Verkehrssicherheit von uns allen wird es ihnen danken.
Weiterführende Links
Video von ZDF heute zur Monocam
hier klicken
Forschungsberichte der UDV zur Unfallursache „Ablenkung“
hier klicken
hier klicken
hier klicken
§ 23 StVO
hier klicken
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz
hier klicken
Stellungnahme des ADAC
hier klicken
Handyblitzer in den Niederlanden
hier klicken
Entscheidung des BVerwG zu „Section Control“
hier klicken
Professor Dr. Dieter Müller ist Verkehrsrechtsexperte und Träger des Goldenen Dieselrings des VdM. An der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) lehrt er Straßenverkehrsrecht mit Verkehrsstrafrecht. Zudem ist er Gründer und Leiter des IVV Instituts für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten sowie unter anderem Vorsitzender des juristischen Beirats des DVR. An dieser Stelle kommentiert der Fachmann Aktuelles zu Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und Verkehrspoliti
Foto: Susanne Plank/Pixabay