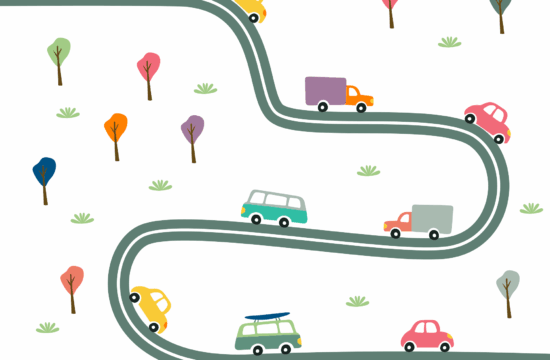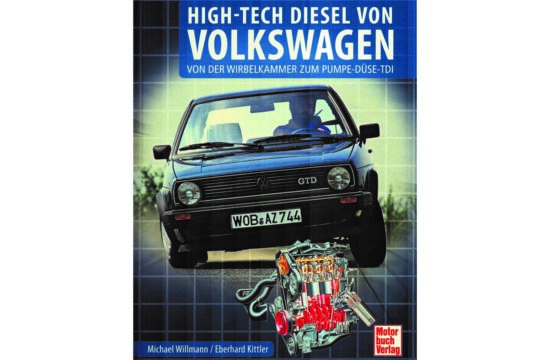Die Hansestadt Hamburg, die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sowie der Landkreis Ludwigslust-Parchim erproben aktuell im On-Demand-Angebot des ÖPNV hochautomatisierte sogenannte „Robotaxis“. Der technologische Weg hin zum erwünschten autonomen Fahren gewinnt bundesweit an Fahrt.
Die neuen Projekte
Die Agora Verkehrswende lud am 26. Mai zum alljährlichen „Agora-Stadtgespräch“ in das Verkehrsmuseum nach Dresden ein und mehr als 90 Verkehrsfachleute aus ganz Deutschland folgten dem Ruf. Der in Berlin beheimatete deutsche Think Tank beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Zukunft der Mobilität in Deutschland und berät Verkehrspolitiker, Kommunalverwaltungen und Landkreise, die neue Wege hin zu einem klimaneutralen Straßenverkehr beschreiten wollen, gemeinnützig und kostenfrei zu allen Verkehrsfragen.
Einer der drei während des Stadtgesprächs angebotenen Workshops hatte das Thema: „Autonome Fahrzeuge für mehr ÖV in der Fläche“. Vorgestellt wurde das Konzept der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) aus dem gleichnamigen Landkreis, dem zweitgrößten Landkreis Deutschlands im Übrigen. Die VLP arbeitet mit dem Berliner Unternehmen „Motor AI“ zusammen, das den für das Projekt in der Anfangsphase vorgesehenen Mercedes-Kleinbus technisch für die Anforderungen des autonomen Fahrens ausgerüstet hat. Der Kleinbus verfügt über mehrere Kameras, Radar und einen Lidar-Laser, die ständig einen 360-Grad Rundumblick des Verkehrsraums erzeugen, der nach den Angaben des Ausrüsters den menschlichen Sinnesempfindungen weit überlegen sei. Der Rufbus (On-Demand) soll zunächst rund um Hagenow und ab dem kommenden Jahr auf weiteren Strecken im Landkreis getestet werden. In den nächsten Jahren werden nach Auskunft von Motor AI allerdings so genannte „Akzeptanzfahrer“ auf dem Fahrersitz im Auto sitzen, damit die Fahrgäste beruhigt sind, weil der Fahrer im Notfall eingreifen und die Lenkung übernehmen könne.
Plakativer verkehrspolitischer Hintergrund der Verkehrsgesellschaft ist der bereits daran spürbar existierende Fahrermangel im ÖPNV: Im Landkreis müssen ca. 20 Prozent aller On-Demand-Anforderungen von Rufbussen aktuell abgelehnt werden, weil nicht genügend Fahrer vorhanden sind.
Vergleichbare Konzepte existieren in Deutschland bereits an zahlreichen Orten und technisch am weitesten vorgedrungen scheint aktuell die Hansestadt Hamburg zu sein, die für eine Erprobung des Konzepts im städtischen Raum steht. Auch der Verkehrsverbund Rhein-Main und die Deutsche Bahn erproben unter dem Projektnamen KIRA autonome Level 4-Fahrzeuge für den Einsatz im ÖPNV. KIRA steht für „KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre“.
Die erforderlichen formalen Schritte
Bevor eine Erprobungsgenehmigung überhaupt erteilt werden kann, ist seit dem Inkrafttreten der Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen (AFGBV) eine durch Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf der Grundlage von § 4 AFGBV von dem betreffenden Fahrzeughersteller zu beantragende und durch das KBA zu genehmigende nationale Betriebserlaubnisse für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion (Level 4) erforderlich.
Alternativ kann ein Hersteller, wie zum Beispiel ein Automobilbauer, später einmal beim KBA auf der Grundlage von Artikel 1 der EU-Verordnung VO (EU) 2022/1426 auch eine EU-Typgenehmigung für autonome Fahrzeuge (Level 4) beantragen, wenn er zunächst in einer Kleinserie autonome Fahrzeuge produzieren möchte. Der Vorteil ist, dass eine solche EU-Typgenehmigung dann für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim teilte im Rahmen des Workshops mit, dass das KBA die Erprobungsgenehmigung erteilt habe und nun der Probebetrieb praktisch geplant werde. Tatsächlich veröffentlichte das KBA im April dieses Jahres eine zehnseitige Liste mit mehr als 100 bereits erteilten Erprobungsgenehmigungen. Das KBA stellt auf seiner Website vollkommen transparent sämtliche erforderlichen Formulare zum Download zur Verfügung, die zur Erteilung der Erprobungsgenehmigung erforderlich sind. Weil aber im Rahmen der Erprobungsgenehmigung neben einer Deaktivierungs- ebenfalls eine Übersteuerungsmöglichkeit des Fahrzeugs gegeben sein muss, ist des Weiteren eine „Technische Aufsicht“ erforderlich, die das gesamte Verkehrsgeschehen im und um das Kfz im Blick behalten und notfalls eingreifen kann. Nur technisch besonders qualifizierte Personen dürfen diese wichtige Funktion übernehmen.
Im nächsten formalen Schritt tritt die Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen auf den Plan, wonach von der im betreffenden Bundesland zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine zuvor vom Halter des Kfz beantragte Betriebsbereichsgenehmigung erteilt werden muss, in der festgelegt wurde, auf welchen öffentlichen Straßen die Erprobungsfahrten stattfinden dürfen.
Probleme und Risiken
Nach wie vor sind in dieser ganzen Kette von Planungen, Rechtsvorschriften, Anträgen und Genehmigungen die handelnden Menschen die Schwachstellen im System, aber nichtsdestotrotz ist die technische Entwicklung nicht mehr aufzuhalten, auch vor dem Hintergrund nicht, dass Deutschland mit seinen in diesem Feld tätigen Technologieformen in einem harten internationalen Wettbewerb mit Anbietern aus den USA und China steht, also derzeit noch zu den Top-3 in der Welt zählt. Wir müssen also die Technik erproben, wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen. Deutschland hat dabei den großen Vorteil, dass wir hier mit unseren Rechtsgrundlagen und Genehmigungsverfahren weltweit die Spitzenposition für das sichere Erproben dieser Technik einnehmen.
Zu den Problemen, die noch in den Griff zu bekommen sind, gehört zum Beispiel die Sensorik in den Erprobungsfahrzeugen, die fehleranfällig sein kann. Zum Zweck der Absicherung sind also redundante Systeme erforderlich, die notfalls einspringen, wenn die vorrangige Technik versagt, wie beispielsweise ein Absturz des Car-PC. Jederzeit muss deshalb ein Ersatz-PC einspringen können. Oder: Der Elektroantrieb muss durch ein Ersatzsystem abgesichert werden, damit das Kfz auch eine Kreuzung verlassen kann, wenn der Hauptmotor ausfällt. Andere Probleme, wie etwa das Einberechnen manchmal chaotischer Verhaltensmuster analoger Verkehrsteilnehmer, -wie die von Radfahrern und Fußgängern, hat die Software der hochautomatisierten Autos noch nicht vollends im Griff, wie eine im Jahr 2024 veröffentlichte aktuelle Studie nachweist, die insbesondere technische Schwierigkeiten bei Abbiegevorgängen der automatisierten Fahrzeuge herausfand.
Alles Vorgenannte ist für die kommenden Jahre ausschließlich für die Erprobung von Konzepten im ÖPNV gedacht, aber der nächste Schritt wird zwangsläufig die Erprobung im Güterverkehr sein, wo derselbe Fahrermangel konstatiert werden muss wie im ÖPNV. Die praktische Verfügbarkeit von hoch- und vollautomatisierten oder gar autonom fahrenden Fahrzeugen im Privatbereich befindet sich noch in sehr weiter Ferne und dürfte bei anzunehmenden Verkaufspreisen der betreffenden Luxuskarossen der Premiumhersteller im sechsstelligen Euro-Bereich liegen für die Masse finanziell kaum erschwinglich sein.
Aber deshalb auf Forschung und Erprobung zu verzichten, wäre die falsche Option, denn wie steht es schon im aktuellen Koalitionsvertrag der CDU/CSU-SPD Regierungskoalition: „Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für autonomes Fahren und werden mit den Ländern Modellregionen entwickeln und mitfinanzieren.“ (S. 28) Und das wollen wir nur allzu gern glauben …
Weiterführende Links
Amtliche Informationen und Unterlagen des KBA zur Erprobungsgenehmigung
hier klicken
Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen
hier klicken
Koalitionsvertrag CDU/CSU-SPD Regierungskoalition
hier klicken
Studie aus nature communications zu Verkehrsunfällen autonomer Kfz
hier klicken
Agora Think Tanks
hier klicken
Reportage von Deutschlandfunk Nova zum autonomen Fahren
hier klicken
SPIEGEL-Artikel zum Verkehrsversuch des RMV
hier klicken
ZEIT-Artikel zum Verkehrsversuch der VLP
hier klicken
Professor Dr. Dieter Müller ist Verkehrsrechtsexperte und Träger des Goldenen Dieselrings des VdM. An der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) lehrt er Straßenverkehrsrecht mit Verkehrsstrafrecht. Zudem ist er Gründer und Leiter des IVV Instituts für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten sowie unter anderem Vorsitzender des juristischen Beirats des DVR. An dieser Stelle kommentiert der Fachmann Aktuelles zu Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und Verkehrspolitik.
Foto: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang