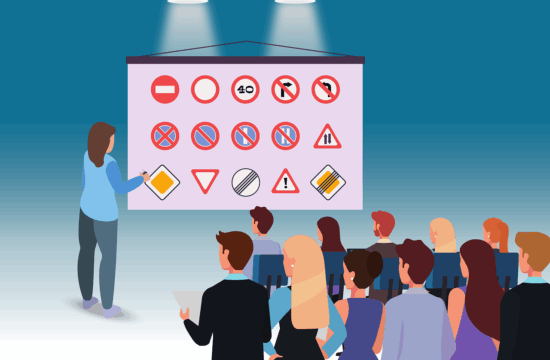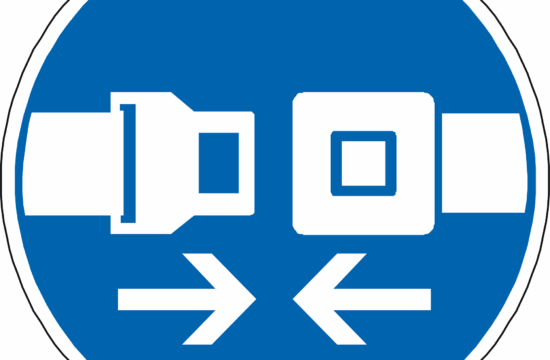Ein Leben für die Sicherheit im Straßenverkehr und für die Vision Zero: Mit dem diesjährigen Träger des Goldenen Dieselrings des VdM, Dr. Wolfram Hell, wurde ein Mediziner geehrt, für den die Erforschung von Unfällen und ihren Ursachen ganz oben auf der Prioritätenliste zur Rettung von Menschenleben im Straßenverkehr sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit steht. Über die Highlights seines bisherigen beruflichen Lebens, seine Wünsche an die Verkehrssicherheit und seine weiteren Herausforderungen sprach Isabella Finsterwalder mit dem renommierten Arzt und Spezialisten für Traumabiomechanik.
Der Motorjournalist: Sie sind von Haus aus Mediziner. Wie kamen Sie zur Unfallursachenforschung?
Wolfram Hell: Als ich 1984 als angehender Mediziner in München im Klinikum rechts der Isar im ersten klinischen Semester gehört hatte, dass es eine Doktorarbeit bei der Firma BMW zum Thema Pkw-Unfälle gibt, war ich sofort begeistert. Meine Idee als Motorradfahrer war es, eine Promotion zu Motorradunfällen durchzuführen. BMW war von meinem Vorschlag angetan. Daraufhin haben wir unter meiner Initiative ein Team von Studenten der Technischen Universität München (TUM) zusammengestellt. Einer der Unterstützer der TUM zum Thema Unfallforschung war Professor Max Danner, ebenfalls Träger des Goldenen Dieselrings des VdM und früherer Leiter des Allianz Technik Zentrums. Zusammen mit dem bayerischen Innenministerium und der Polizei haben wir dann 1985 die Genehmigung erhalten, Motorradunfälle mit schweren Verletzungen zu untersuchen. Innerhalb von zwei Jahren konnten wir schließlich 210 Unfälle untersuchen. Bei diesen teilweise sehr schweren oder auch tödlichen Unfällen gingen wir immer der Frage nach, wie sich das Ganze künftig sicherer machen lässt.
… und spätestens mit dieser Aufgabe haben Sie Ihr Herz ganz an die Unfallursachenforschung verloren, richtig?
Genau, denn ich habe schnell festgestellt, dass in diesem Bereich der Medizin eine Lücke klafft und es einen konkreten Bedarf gibt, Verletzungen und Unfälle zu reduzieren.
Wie lauteten die konkreten Ergebnisse Ihrer Doktorarbeit zu Motorradunfällen?
Im Zentrum unserer Forschung stand immer die Frage, wie die Motorradmobilität sicherer gemacht werden kann, zum Beispiel durch eine höhere Helmeffektivität infolge einer verbesserten Fixierung des Helmes. Auch haben wir bereits damals Airbags auf dem Motorrad angedacht. Insgesamt haben wir in unserer Untersuchung verschiedene Unfalltypen für den Bereich Motorrad herausgearbeitet. Diese Studie durfte ich übrigens auch in den USA präsentieren, wo ich einen Teil meines praktischen medizinischen Jahres absolviert habe.
Wie ging es nach der Studie und Beendigung Ihres Studiums weiter?
Auf einer internationalen Konferenz stieß ich auf Professor Klaus Langwieder, seines Zeichens Unfallforscher und langjähriger Leiter des Instituts für Fahrzeugsicherheit des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ich werde nie seine Verwunderung darüber vergessen, dass er in Paris zum Thema Unfallursachenforschung auf einen jungen Mediziner aus München getroffen ist. Bei dieser Gelegenheit lud er mich an das von ihm geleitete Institut für Fahrzeugsicherheit des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft – früher hieß es HUK Verband – ein. Dort bot er mir eine Mitarbeit in einer Studie zur Untersuchung der tödlichen Autobahnunfälle im Freistaat Bayern und zur Überlegung der Einführung eines Tempolimits an. In den 1990er-Jahren nach der Wiedervereinigung war dies ein riesiges Thema. Kurzum, ich nahm das Angebot von Prof. Langwieder an und wechselte ans Institut für Fahrzeugsicherheit.
Wie lauteten die wichtigsten Ergebnisse dieser Großzahluntersuchung für Prof. Langwieder?
Wir haben beispielsweise eruieren können, dass 24 Prozent der tödlichen Unfälle auf Autobahnen in Bayern durch Einschlafen am Steuer verursacht wurden. Überdies haben wir in dieser Studie herausgefunden, dass die unter 45-Jährigen in der Regel am frühen Morgen oder in der Nacht auf der Autobahn einschlafen und die über 45-Jährigen nach dem Mittagessen oder am Nachmittag. Diese Ergebnisse haben wir zudem mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Medizin nochmals genauer untersucht, da man unseren Ergebnissen erst keinen Glauben schenken wollte. Die Kollegen der deutschen Schlafforschung haben ihre Materialien anschließend in den USA, in England und Frankreich überprüfen lassen. Das Ergebnis: Dort war es genauso wie bei uns. Mit unserer Unfallursachenforschung konnten wir schon damals belegen, wie gefährlich Monotonie am Steuer ist. Schon damals habe ich mich daher für Rüttelstreifen stark gemacht, wie sie es in Großbritannien, in Schweden, Spanien oder teilweise in den USA, wie auf dem Pennsylvania Turnpike, schon gab. Diese reduzieren ein Abkommen von der Fahrbahn um bis zu 80 bis 90 Prozent. Nach langen Überlegungen wurden Rüttelstreifen übrigens jetzt endlich auch in Deutschland auf einer Teststrecke zwischen Berlin und Hamburg durch die Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführt. In der Folge ergaben sich auch bis zu 80 Prozent weniger Unfälle. Leider werden diese Rüttelstreifen bei uns wegen verschiedenster Vorbehalte wie Lärm oder Hindernisse für Schneeräumer nach wie vor nur zu selten implementiert obwohl in Schweden und Kanada hier keine Probleme gesehen werden.
Das Thema Vernetzung steht für Sie im Bereich der Unfallursachenforschung ganz weit oben auf der Agenda. Was steckt dahinter?
Fakt ist: Wir müssen in der Unfallursachenforschung immer das Zusammenspiel von Mensch, Fahrzeug und Umfeld und damit das Ganze betrachten. Sprich, es gilt den Menschen von der Medizin und Psychologie her, aber auch mit Blick auf Alkohol und Drogen in den Fokus zu rücken; das Fahrzeug muss in puncto Sicherheitsgurte/Airbags und steifer Fahrgastzelle fokussiert werden und schließlich heißt es, das Umfeld in Bezug auf Straßenbau und Straßenarchitektur unter die Lupe zu nehmen. Sämtliche Elemente sind hochrelevant, wenn es darum geht, Unfälle zu verhindern. Leider ist die Vernetzung dieser drei unterschiedlichen ‚Fakultäten‘ in Deutschland immer noch nicht perfekt – ganz im Gegensatz beispielsweise zu Schweden, wo das Prinzip der Interdisziplinarität konsequent gelebt wird. In Schweden sitzen nach jedem tödlichen Unfall Fahrzeugingenieure, Mediziner und Straßenbauingenieure an einem Tisch und gestalten das System gemeinsam hochgradig effektiv und sicher. Genau das ist im Übrigen das Ziel, das ich als Präsident der Gesellschaft für Medizinische und Technische Traumabiomechanik e.V., die in der DACH-Region aktiv ist, verfolge.
Sie sind seit 2016 Präsident der Gesellschaft für Medizinische und Technische Traumabiomechanik e.V., kurz gmttb. Wie arbeitet die gmttb? Welche Ziele im Einzelnen haben Sie dort als Präsident?
Ziel der gmttb sind interdisziplinäre Gutachtenstandards, die Optimierung der Ausbildung für Gutachter sowie eine bessere Vernetzung der deutschsprachigen Experten auf diesem Gebiet. Insgesamt versuche ich, die Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben, in ihrer Gesamtheit zu erfassen und nach draußen in die Öffentlichkeit zu bringen. Als Botschafter der 1997 von meinem schwedischen Freund Prof. Claes Tingvall erdachten schwedischen Vision Zero versuche ich dieses Thema in D A CH, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kräftig nach vorne zu bringen. Dabei soll das System so gestaltet sein, dass, selbst wenn Menschen Fehler machen, es keine tödlichen Unfälle mehr gibt. Hier war die dritte Global Ministerial Conference on Road Safety in Stockholm 2020 ein weiterer riesiger Meilenstein zur weltweiten Umsetzung der Vision Zero mit über 80 Verkehrsministern – von deutscher Seite war allerdings leider kaum jemand vertreten. Überhaupt hat es in Deutschland länger gedauert, bis die Vision Zero Einzug gehalten hat – das war erst 2007 (DVR) – , weil die Menschen hier anfangs leider das Prinzip zunächst sogar bekämpft hatten.
Insgesamt setze ich alles daran, das Thema Traumabiomechanik, also die Entstehung und Prävention von Verletzungen, in unserer Gesellschaft zu bündeln und mit den verschiedenen Kollegen aus den einzelnen DACH-Ländern in einem kleinen Kreis offen zu diskutieren und zu überlegen, wie wir hier weiter vorankommen. Außerdem möchte ich mit der gmttb erreichen, dass wir das, was in anderen Ländern – allen voran in Schweden, UK und der Schweiz – hervorragend funktioniert, auch bei uns einführen und nicht wieder von vorne anfangen müssen. Wer die Vision Zero in Europa übrigens auch fahrzeugtechnisch sehr gut umsetzt, ist Frankreich. Hier gibt es das vom Renault/PSA jetzt Stellantis Konzern seit 1969 finanzierte und von einem Mediziner geleitete LaboratorieBiomechanique LAB. Hier wird viel dafür getan, um Fahrzeuge und das System sicherer zu machen. So etwas wünsche ich mir nach wie vor auch für Deutschland.
Seit wann gibt es eigentlich den Begriff der Traumabiomechanik? Wie ist sie entstanden?
Der Ursprung der Traumabiomechanik kommt von der Universität München, konkret vom Mediziner Otto Messerer, der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Abhandlung über die Festigkeit von Knochen verfasst und dafür jeden Knochen des Menschen auf Bruchfestigkeit, also Torsion oder Biegung, untersucht hat. Er war der Pionier auf diesem Gebiet. Danach ging das Ganze jedoch nach Amerika und wurde vom Mediziner John Paul Stapp von der U.S. Air Force vorangetrieben. Dieser hat in den 1950er-Jahren festgestellt, dass JetPiloten meistens nicht durch Flugzeugabstürze, sondern vielmehr infolge von Autounfällen, ums Leben gekommen sind. Stapp hat dann als Erster versucht, die Unfallforschung auch für den Pkw-Bereich zu etablieren. Daraufhin wurden die ersten Sicherheitsgurte vom Flugzeug ins Auto implementiert. Sein Leitsatz: ‚Ich bin ein Kämpfer gegen unnötige Todesfälle‘.
Was bedeutet dieser Satz übertragen auf Sie und Ihre Forschung?
Auch ich bin ein konsequenter Verfechter dieses Leitsatzes. Selbstverständlich gibt es eine traumabiomechanische Grenze für das, was Menschen aushalten können. Aber innerhalb des Toleranzbereichs will ich nicht, dass Menschen sterben oder als Schwerstverletzte enden müssen, sprich, als Rollstuhlfahrer, Koma-Patienten oder Schwerstbrandverletzte. Diese Langzeitpatienten sind mir am meisten an die Seele gegangen.
Welche Erfindung war für Sie in Sachen Verkehrssicherheit bisher am entscheidendsten?
Allen voran sind es der rückwärtsgerichtete Kindersitz und der Dreipunktgurt. Der schwedische Mediziner Dr. Bertil Aldman hat den rückwärtsgerichteten Kindersitz 1964 entwickelt – basierend auf der Erkenntnis, dass die Astronauten mit der Apollo ebenfalls rückwärtsgerichtet gelandet sind. Aldmann hat überlegt, dass ein derartiger Sitz für Kinder mit ihrem großen Kopf und einer noch instabilen Wirbelsäule lebensrettend sein kann. Zum anderen gab es den gelernten Flugzeugingenieur Nils Bohlin, der später für Volvo tätig war und den Dreipunkt-Sicherheitsgurt Ende der 1950er Jahre erfunden hat – die achtwichtigste Erfindung der Welt für die gesamte Menschheit!
Was waren Ihre größten Erfolge der bisherigen Traumabiomechanik?
Auf den Punkt gebracht: Das Optimieren von Fahrrad- und Motorradhelmen zählt für mich zu den größten Errungenschaften der Traumabiomechanik. Darüber hinaus ist die Vernetzung der einzelnen Disziplinen auf diesem Gebiet ein weiterer großer Erfolg. Diesen interdisziplinären Ansatz mit Medizinern, Juristen, Polizisten, Physikern Mathematikern und Unfallgutachtern bei der Unfallursachenforschung weiter zu befeuern, halte ich für außerordentlich wichtig. Als begeisterter Networker und einer, der über den Tellerrand schaut, bin ich überdies stolz, dass das IFM seinerzeit den dynamischen Sitztest in Form von Verbrauchertests entwickelt hat und diesen dann weltweit bekannt gemacht hat. So etwas ist sehr wichtig, um von außen Druck auf die Fahrzeugindustrie zu machen, damit diese zentrale Sicherheitsstandards nutzt. Beispielsweise hat es lange gedauert, bis es beim VW Golf, dem damals meistverkauften Auto in Deutschland, wirklich gute Sitze und Kopfstützen gab. Es darf doch nicht sein, dass hier aus finanziellen Erwägungen an der Sicherheit gespart wird, wie unter dem damaligen, knallharten VW Einkaufschef Lopez geschehen.
Nach zwölf Jahren als Bereichsleiter Biomechanik und Medizin am Institut für Fahrzeugsicherheit München (IFM) unter den Professoren Max Danner und Klaus Langwieder waren Sie seit 14 Jahre Leiter der Abteilung Biomechanik und Unfallanalyse am Institut für Rechtsmedizin der LMU München. Wie lauten die Highlights?
An der LMU habe ich die Unfallforschungsabteilung in der Rechtsmedizin aufgebaut. Dazu gehörte eine Datenbank für Getötete, die Kernkompetenz der Rechtsmedizin, zu erstellen. Mit dem Rechtsmediziner Prof. Eisenmenger und ehemaligen Vorstand unseres Instituts hatten wir einen der besten Teamplayer überhaupt gehabt, um diese Datenbank aufzubauen. Das trägt jetzt Früchte, denn die junge Generation bringt die GIDAS (German In-Depth Accident Study), eine Studie zur vertieften Verkehrsunfalldatenerhebung als Gemeinschaftsprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT), weiter voran. So zielt die GIDAS auf eine umfassende Dokumentation von Verkehrsunfällen mit Personenschäden ab. Forschungsnehmer sind hier die LMU, die Hochschule München, die Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden sowie die Medizinische Hochschule Hannover.
Derzeit finalisiere ich für unseren Lehrstuhl eine Studie mit dem Mobilitätsreferat in München über Fahrrad-, E-Bike und E-Scooter Unfälle. Als ‚Elder Statesman‘ an der LMU und sowie Hochschule München setze ich zudem alles daran, die jungen Nachwuchswissenschaftler interdisziplinär auszubilden und zu unterstützen.
Wir hatten übrigens beim Aufbau der Datenbank damals zahlreiche Widerstände, da viele nicht geglaubt haben, dass es möglich ist, einen Verkehrsunfall mit dem jeweiligen Obduktionsergebnis zu matchen, um daraus die entsprechenden Erkenntnisse zu ziehen. Wir haben beispielsweise eine sehr große europäische Studie durchgeführt, bei der wir die Alkohol- und Drogenanalyse mit Unfällen korreliert haben. Zudem haben wir am Thema HWS-Distorsion, sprich Schleudertrauma, gearbeitet. Zu diesem Zweck haben wir auch einen weiblichen Dummy mitentwickelt, dessen Halsumfang als Risikofaktor definiert wurde: Je geringer der Halsumfang, desto höher die Belastung – meist ein Riesenunterschied zu männlichen Dummys, was bei Sitzsystemen und Kopfstützen berücksichtigt werden muss. Sprich. Es ist wichtig, auch die Frau als Dummy oder Simulationsmodell zu haben, um den Unfall exakt nachzuvollziehen und entsprechende Sicherheitssysteme weiter optimieren zu können.
Wie lauten Ihre nächsten Ziele für das Thema Verkehrssicherheit? Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen? Welche Wünsche haben Sie zu diesem Thema?
Selbstverständlich habe ich hier noch viele Wünsche, ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht jedoch eine Schwerstverletzten-Datenbank, aus der wir stichprobenartig Querschnittsgelähmte oder Koma-Patienten beispielsweise nach Pkw-Unfällen erfassen können, um zu prüfen, warum es dazu kommen musste und wie wir das mit einfachen, bezahlbaren Mitteln verhindern können. Leider haben wir bisher bei der GIDAS zu wenig schwerste Fälle. Das heißt, wenn ich mit Häusern zusammenarbeiten kann, z.B. wie der Unfallklinik in Murnau, in die ja permanent Querschnittsgelähmte per Helikopter eingeliefert werden, könnte ich über Stichproben verfügen und bei meiner Arbeit viel schneller vorankommen. Ein weiterer Herzenswunsch von mir ist es, die Zahl der Verkehrstoten mit Hilfe vernünftiger Sicherheitsmaßnahmen weiter deutlich zu reduzieren z.B. durch eine Trennung mit Mittelleitpfosten auf Landstraßen wie in Schweden (minus90 Prozent der Verkehrstoten), da die ungetrennte Landstraße mit Abstand die gefährlichste Straße ist und die Verkehrsteilnehmer eine kleine Fehleinschätzung bitter bezahlen. Kurzum: Um Sicherheit im Verkehr nachhaltig zu gestalten, brauchen wir ein Leitprinzip, sprich einen interdisziplinären Ansatz. Dafür werde ich auch künftig kämpfen.
Lassen Sie uns auf die Mobilität der Zukunft schauen: Denken Sie, dass durch die weitere Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen bis hin zum autonomen Fahren das Thema Verkehrssicherheit im Laufe der nächsten Jahre zurückgedrängt wird?
Ein klares Nein, denn selbst autonom betriebene Fahrzeuge können verunfallen. Daher brauchen wir auch künftig entsprechende Schutzsysteme im Auto, wie Airbags, Gurtstraffer oder hochfeste Fahrgastzellen. Auch den ÖPNV gilt es künftig noch sicherer zu gestalten. Beispielsweise haben die Züricher jetzt mit Airbags an Straßenbahnfronten begonnen. Hier gibt es noch immenses Potenzial. Wenn Sie bedenken, dass es zwischen 2000 und 2018 etwa 500.000 Tote durch Unwetter und Hurricanes gab, 900.000 Tote durch Kriege, jedoch 25 Millionen Tote durch Verkehrsunfälle – davon 1,2 Millionen Kinder –, wird die Tragweite schnell deutlich. Auch in Deutschland, wo es heißt, der Verkehr sei sicher und wir hätten die besten Autos der Welt, zahlen wir immer noch einen zu hohen ‚Blutzoll‘. So ist bei den unter 40-jährigen Deutschen die häufigste Todesursache der Verkehrsunfall. Gerade durch die Smartphonenutzung und Ablenkung am Steuer stirbt in den USA jeder Zehnte im Verkehr. Besonders SMS und Whatsapp sind gefährlicher als Alkohol. In Deutschland gibt es dazu noch keine Statistik, weil es heißt, wir können das nicht matchen. Hierzulande gibt es viele junge Leute, die mit Kopfhörern durch den Verkehr laufen und sich der Gefahr nicht bewusst sind. Angesichts von Mobiltelefonen sind wir in einer neuen Zeit angekommen und müssen hier – um Schlimmeres zu verhindern – dringend eingreifen. Beispielsweise müssen wir uns schnellstens überlegen, wie Telefone während der Fahrt wie im Flugzeug am besten automatisch in einen speziellen Modus geschaltet werden können.
Ihre Vision einer sicheren Mobilität der Zukunft?
Das System sollte immer so gestaltet sein, dass es selbst dann, wenn Menschen im Straßenverkehr Fehler machen, es fast keine tödlichen Verletzungen gibt. Das bekommen wir ja auch nahezu im Flugverkehr mit europaweit nurmehr 150 bis 300 Toten jährlich hin (in Europa >20.000 Verkehrstote). Unser Ziel in der Verkehrssicherheit sollte es sein, auf den Luftverkehrsstandard zu kommen. Die Schweden machen es uns beispielsweise auch im Radverkehr vor. Hier tragen in Stockholm 90 Prozent der Fahrradfahrer freiwillig einen Helm, in Deutschland sind es gerade einmal 25 Prozent. Zudem werden in Schweden die Fahrradwege, wie von Kinderspielplätzen bekannt, mit energieabsorbierenden Materialien am Rand gesichert, so dass Fahrradfahrer im Fall des Falles weich fallen. In Deutschland sind manche Bordsteinkanten sehr ungünstig geformt. Zudem sollte die Straßenarchitektur z.B. wie in Kopenhagen immer so intelligent gestaltet sein, dass es erst gar nicht zu Konfliktsituationen im Verkehr kommt.
Worauf sind Sie beruflich besonders stolz?
Wir hatten im IFM in den 1990er-Jahren mit 15.000 Pkw-Pkw Unfällen die größte Unfalldatenbank Europas. Damit haben wir eine große Transparenz für das Unfallgeschehen geschaffen. So haben wir damals die Crash-Standards mit den realen Unfallverletzungen verglichen und überlegt, wie die Crash-Standards besser gestaltet und Fahrzeuge sicherer gemacht werden können. Außerdem bin ich sehr stolz auf den von uns entwickelten dynamischen Sitztest. Last, but not least war ich sehr stolz darauf, in den 90er-Jahren für Prof. Danner ein Gutachten über Rücksicherheitsgurte in VW Fahrzeugen in den USA machen zu können. Das hat er sehr gewürdigt.
Ihr persönliches Lebensmotto?
Steter Tropfen höhlt den Stein – ich freue mich, wenn ich etwas gerne machen und dabei zumindest eine Kleinigkeit bewegen kann.
Ihr Herzensappell an die Branche in puncto Sicherheit?
Volvo gibt sämtliche Sicherheitsextras für den Rest der Welt frei, weil diese Menschenleben retten. Viele andere Hersteller machen das noch nicht. Kurzum, ich bin überzeugt, dass jede einzelne Erfindung in Sachen Sicherheit (wie der Polio-Impfstoff von Salk), für alle weltweit freigegeben werden sollte. Auch sollten Sicherheitssysteme nicht nur gegen Aufpreis erhältlich sein und weltweit alle Fahrzeuge den gleichen Sicherheitsstandard besitzen. Sicherheit hat schließlich mit Menschenleben und -würde zu tun – und beides ist unantastbar.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Hell, für dieses interessante Gespräch mit Ihnen.
Text: Isabella Finsterwalder
Fotos: Mica Zeitz, Dr. Wofram Hell


Vita Dr. Wolfram Hell
Der 65-Jährige ist approbierter Arzt und Spezialist für Traumabiomechanik. Er ist Präsident der gmttb: Gesellschaft für Medizinische und Technische Traumabiomechanik e.V. (D-A-CH), im Vorstandsausschuss des DVR Erste Hilfe und Verkehrsmedizin und hat am Verkehrssicherheitsprogramm 2030 der Bundesregierung mitgewirkt. Dr. Hell war zwölf Jahre Bereichsleiter Biomechanik und Medizin am Institut für Fahrzeugsicherheit München IFM (Prof. Danner, Prof. Langwieder), danach 14 Jahre Leiter der Abteilung Biomechanik und Unfallanalyse im Institut für Rechtsmedizin der LMU München.
Sein Spezialgebiet ist die biomechanische Unfallforschung und Prävention. Ein Schwerpunkt liegt bei der Erforschung von HWS Distorsionsverletzungen (3 EU-Forschungsprojekte). Mit Durchführung von Freiwilligenversuchen wurde ein HWS Dummy (BIORID) entwickelt. Er hat den aktuellen Fahrzeugsitz- und Kopfstützenteststandard initiiert IIHS und Euro-NCAP und mitgestaltet. Ferner wurden Kindersitztest- und Fahrradhelmteststandards optimiert. In Großzahluntersuchungen wurden typische Verletzungsmuster bei Pkw-Kollisionen ermittelt. Weitere Untersuchungen betrafen die Verletzungsmuster von Fußgängern, Fahrradfahrern, Motorradfahrern und Lkw- und Businsassen. Es besteht eine langjährige Erfahrung in Gerichts- und Versicherungsgutachten bei Unfällen. Hell ist zudem Botschafter der schwedischen „Vision Zero“ in D-A-CH sowie in Indien und VAE.